#nr21 | Recherche
Du kommst hier nicht rein! (1. Juli 2021)



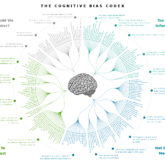
von Christina Elmer
Zum Start ein Gedankenexperiment: Sie recherchieren für eine Reportage zur Entwicklung der Kriminalität in Ihrer Stadt. Wo spielt diese Reportage? Vermutlich haben Sie an einen bestimmten Stadtteil gedacht. Aber warum? Nachrichten, Statistik, eigene Erfahrungen – viele Faktoren können solche Assoziationen beeinflussen. In der Regel ist dieser Prozess aber unbewusst und lässt vieles außen vor, das wir eigentlich wissen oder wissen könnten. Zugleich: Bei der Masse an Informationen, die uns jeden Tag erreichen, sind derartige Filter und Schemata alternativlos. Kaffee oder Tee zum Frühstück? Schon damit wären wir sonst stundenlang beschäftigt. (mehr …)

von Pascal Patrick Pfaff (mehr …)

Christian Fuchs arbeitet für das Investigativ-Ressort der ZEIT und gilt als Experte zur Neuen Rechten. Gemeinsam mit Paul Middelhoff hat er das Buch „Das Netzwerk der Neuen Rechten“ geschrieben. Im Interview spricht er über ethische Grenzgänge, erklärt, warum ihn seine Recherchen über deutsche Nationalisten ins Ausland geführt haben, und er verrät, was er seinem jungen Ich heute mit auf den Weg geben würde. (mehr …)

von Leonie Wunderlich (mehr …)

von David Baldauf (mehr …)

Der Spiegel ist seit vielen Jahren für seine investigativen Recherchen und Enthüllungen bekannt. Doch erst im September des vergangenen Jahres hat sich das Magazin dazu entschieden, ein eigenes Investigativ-Team aufzubauen. Warum fiel die Entscheidung erst so spät?
Schmitt: Die Frage, ob Der Spiegel ein Investigativ-Team braucht, haben wir in unserem Haus immer wieder diskutiert und zwar nicht nur unter der jetzigen Chefredaktion, sondern auch unter der Chefredaktion von Georg Mascolo und Stefan Aust. Dagegen sprach lange Zeit, dass sich das Magazin als Inbegriff der investigativen Recherche versteht und wir die investigative Recherche quasi in unserer DNA tragen. Die Kollegen sollten über alle Ressorts hinweg investigativ arbeiten und es bestand die Sorge, dass durch die Gründung eines Investigativ-Teams diese intensive Recherche zurückgefahren würde.

Jörg Schmitt arbeitet seit mehr als 15 Jahren beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel und gehört zu den erfahrensten Rechercheuren in Deutschland. Der gebürtige Marburger studierte Journalistik, Wirtschaftspolitik und Jura in München. Nach Stationen beim stern und dem Manager Magazin kam er 2003 zum Spiegel, wo er mittlerweile als „Koordinator Investigativ“ arbeitet. Seine Spezialgebiete sind Wirtschaftskriminalität und Korruption. Schmitt enthüllte zahlreiche Affären im Bereich Industrie, Finanzen, Rüstung, Politik und im Sport. Dafür gewann er unter anderem den Henri-Nannen- und den Otto-Brenner-Preis. Zuletzt sorgten die Enthüllungen um die Football Leaks, AIRBUS und den Weißen Ring in Lübeck für Aufsehen.
Doch mittlerweile hat sich die Medienwelt enorm verändert. Immer mehr Medien setzen auf die investigative Recherche, damit ist auch der Konkurrenzdruck größer geworden. Darauf haben wir reagiert. Ziel war es, die investigativen Kräfte in unserem Haus stärker zu bündeln und die Kommunikation untereinander zu stärken. Es kam nämlich immer mal vor, dass Kollegen aus den verschiedenen Ressorts an derselben Geschichte saßen und keine Ahnung voneinander hatten. Zum zweiten wollten wir internationale Allianzen schließen und letztlich auch nach außen sichtbar machen, dass das Magazin großen Wert auf investigative Geschichten legt. Ich glaube, die Rechercheergebnisse des ersten Jahres zeigen, dass das eine sinnvolle Entscheidung war.
Viele sagen, dass die Recherche im Journalismus der Qualitätstreiber schlechthin ist. Würden Sie dieser Aussage zustimmen?
Viele Medien haben in den letzten Jahren an Bedeutung verloren und versuchen, über die Recherche diesen Bedeutungsverlust zu mindern. Das ist meiner Meinung nach ein richtiger Ansatz, aber immer wieder fällt auch auf, dass neugegründete investigative Ressorts mehr oder weniger Lippenbekenntnisse waren. Es kommt auch immer wieder vor, dass Medien Geschichten als exklusiv und wahnsinnig wichtig verkaufen, obwohl die eigentlich ein alter Hut sind. Jede kleine Geschichte gleich zum Mega-Skandal hochzuschreiben schadet uns allen – und spielt nur jenen in die Hände, die heute schon alle Medien als „Fake News“ verleumden. Grundsätzlich trägt die Konzentration auf investigative Geschichten aber eindeutig zur Qualitätssteigerung fast aller Medien bei.
Welche Veränderungen und Herausforderungen bringt diese intensivierte Recherche in den Medienhäusern, gerade auch mit Blick auf Datenleaks, mit sich?
Bei Enthüllungen wie den Football Leaks ist die Menge an auszuwertendem Material enorm gestiegen. Heutzutage bekommen Redakteure einen Stick, der ist so groß wie ein Daumen und beinhaltet gleich Zehntausende von Dokumenten. Da sind natürlich meist sehr viel spannende Inhalte dabei, aber ein großer Teil ist eben auch uninteressant. Wir nutzen dafür inzwischen eine Software, die auch bei Ermittlungsbehörden zum Einsatz kommt. Bei den Football Leaks handelte es sich beispielsweise um 1,8 Gigabyte an Daten und die beinhalteten etwa 18 Millionen Dateien, die wir auswerten mussten. Dabei stellt sich natürlich die Frage, wie man es schafft, aus diesen Dateien, die völlig unterschiedliche Themen abdecken, die wirklich starken Geschichten zu finden. Dafür braucht es mittlerweile solche Tools und mit diesen muss man auch umgehen können. So kommt man dann über bestimmte Suchmechanismen auf die richtige Fährte. Beispielsweise indem man bestimmte Suchbegriffe miteinander kombiniert. In diesem Bereich haben wir beim Spiegel in den letzten Jahren eine ganz steile Lernkurve vollzogen.
Investigativer Journalismus ist natürlich immer auch Enthüllungsjournalismus und versucht Missstände und Fehlentwicklungen in Politik Wirtschaft und Gesellschaft aufzudecken. Zuletzt haben Sie auch Missstände im Sport publik gemacht. Sind solche Enthüllungen nach wie vor wirkungsvoll?
Ich glaube der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat mittlerweile eindeutig verstanden, dass er Anfragen unseres Magazins sehr ernstnehmen muss. Politik und die Wirtschaft haben den investigativen Journalismus, den der Spiegel hervorgebracht hat und hervorbringt, immer schon ernstgenommen. Doch mittlerweile ergreifen viele Akteure Gegenmaßnahmen und es werden Agenturen beauftragt, um Enthüllungen abzuwehren. Für so etwas werden mittlerweile hochbezahlte Strategen engagiert. Damit müssen wir umgehen und solche Reaktionen kontern, indem wir schneller sind und immer auch weitere Argumente und Beweise liefern können. Daher gehen wir an viele Geschichten strukturierter und geplanter heran, als das vor 15 oder 20 Jahren der Fall war. Das betrifft auch die Vermarktung. Bei der Medienschwemme heutzutage werden Geschichten nur noch dann wahrgenommen, wenn man sie entsprechend orchestriert. Auch das haben wir erst lernen müssen.
Es gibt Richter, die Medien allem Anschein nach im sprichwörtlichen Sinne hassen
Immer wieder wird gegen Enthüllungen auch gerichtlich vorgegangen. Wie gehen Sie mit juristischen Verfahren um und wie viel Kraft kosten solchen Auseinandersetzungen?
Wir arbeiten sehr sauber und überprüfen die Geschichten vor der Veröffentlichung akribisch. Jeder hat das Recht, sich gegen Berichterstattung zu wehren, aber es gibt dabei Entwicklungen, die ich für sehr problematisch halte. Ein großes Problem ist der sogenannte fliegende Gerichtsstand. Das heißt, jeder kann im Prinzip Medienhäuser verklagen, wo immer er mag. Demnach suchen sich die Konzerne und andere betroffene Akteure immer die Gerichte aus, bei denen mit dem größten Erfolg gerechnet wird. Es gibt Richter, die Medien allem Anschein nach im sprichwörtlichen Sinne hassen, und so kassiert man dann sehr schnell eine einstweilige Verfügung, ohne dass der Redaktion die Möglichkeit gegeben wird, Argumente und Beweise vorzutragen. Das halte ich teilweise für einen Verstoß gegen das Grundgesetz. Wir haben zum Glück eine sehr gute Rechtsabteilung, die darauf vorbereitet ist, aber für freie Journalisten erschwert diese Art der Verrechtlichung die Arbeit enorm.
Der Beruf des investigativen Journalisten ist sehr speziell. Handelt es sich dabei häufig um einsame Kämpfer oder haben sich die Arbeitsweisen mittlerweile verändert?
Früher waren investigative Journalisten Einzelkämpfer. Heute gibt es kaum noch Rechercheure, die als einsamer Wolf Geschichten nachjagen. Investigativer Journalismus ist in den letzten zehn Jahren ganz klar ein Mannschaftssport geworden. Man braucht inzwischen Teamplayer und sollte auf Egoisten und Einzelgänger lieber verzichten. Das liegt auch daran, dass die Themen heute deutlich komplexer sind. Um ein Thema umfassend recherchieren zu können, brauchen Sie Spezialisten aus verschiedenen Bereichen. Als wir im vergangenen Jahr eine große Enthüllung über Korruptionsvorwürfe bei Airbus veröffentlich haben, waren wir auf unterschiedliche Experten angewiesen. Wir brauchten einen Luftfahrtexperten, einen Wirtschaftsexperten, der sich mit Fluglinien auskennt, und jemanden, der perfekt Französisch spricht. Bei anderen Projekten müssen Sie große Datenmengen auswerten, dann brauchen Sie Datenspezialisten und auch jemanden, der am Ende alle Ergebnisse sauber und interessant aufschreiben kann. Das Berufsbild des Journalisten und insbesondere des investigativen Journalisten ist sehr viel arbeitsteiliger geworden und erfordert heute deutlich mehr Teamarbeit als früher. Das heißt aber auch, dass sie lernen müssen Informationen zu teilen. Das fällt nicht immer leicht. Doch die Zeit der einsamen Wölfe ist vorbei.
Die Zeit der einsamen Wölfe ist vorbei
Viele Geschichten werden mittlerweile auch über Grenzen hinweg recherchiert, weil die Handlungen immer internationaler werden und Themen oftmals mehrere Länder betreffen. Wie reagiert Der Spiegel auf diese Entwicklung?
Wir haben das europäisches Netzwerk European Investigative Collaborations (EIC) gegründet. Printmedien aus mehr als zehn Ländern sind daran mittlerweile beteiligt. Ziel war es, einen kleinen Kreis aus Printmedien, die jeweils in einem europäischen Land vertreten sind, einzubeziehen. Zu den Partnern gehören unter anderem Le Soir aus Belgien, Politiken aus Dänemark und El Mundo aus Spanien. Dabei setzen wir auf volle Transparenz nach innen und vertrauen unseren Partnern. Wöchentlich gibt es eine Videokonferenz, wo wir über neue Recherchen sprechen. Über eine verschlüsselte Plattform können wir Dokumente austauschen. Aber wir helfen uns auch gegenseitig bei Recherchen, an denen nicht alle Partner beteiligt sind – und die beispielsweise nur zwei oder drei Länder betreffen.
Sind diese neuen internationalen Recherchenetzwerke also als eine Antwort auf die Globalisierung zu verstehen?
Ja, und ich glaube, dass es die richtige Antwort ist, denn so wie wir in Deutschland sehr gute Zugänge zu vertraulichen Informationen haben, so haben andere Medien wertvolle Zugänge in ihren Ländern. Sie können Quellen, die ihr Land betreffen, außerdem deutlich besser einschätzen als wir. Aber mit den neuen Rechercheverbünden komme auch neue Probleme auf die Medienhäuser zu. In den Staaten gibt es unterschiedliches Medienrecht. Sie können in Deutschland Dinge behaupten, die man in England zum Beispiel nicht behaupten darf. Auch was das Persönlichkeitsrechts angeht, gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen. Bei Kooperationen wird man daher plötzlich mit juristischen Problematiken konfrontiert, die man als einzelnes Medium, das nur in einem Land publizieren will, nicht hätte. Dennoch lohnt sich die grenzübergreifende Zusammenarbeit enorm. Die erste Geschichte des EIC drehte sich im Jahr 2015 um den internationalen Handel mit gebrauchten Schusswaffen und um die Herkunft jener Waffen, die bei den islamistischen Anschlägen in Paris und Kopenhagen verwendet wurden. Seither sind gut ein Dutzend Geschichten gefolgt. Die bekannteste war sicher Football Leaks.
Informantenschutz war und ist ein heikles Thema. Die digitale Surveillance ist vermutlich omnipräsent. Herausgekommen ist auch, dass Telefonate von Spiegel-Redakteuren mit einem hochrangigen Informanten abgehört wurden. Wenn nicht mal mehr das Fernmeldegeheiminis gilt – was kann man Whistleblowern dann noch an Schutz versprechen?
Man kann einige Vorkehrungen treffen, um Informanten und Informationen hinreichend zu schützen. Das hängt aber immer auch davon ab, über welche Themen berichtet wird. Also man sollte sich natürlich nicht in der DFB-Kantine mit einer DFB-Quelle treffen. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, man muss immer abschätzen, um welche Gefährdungsstufe es sich handelt und dann seine Werkzeuge danach ausrichten. Wir arbeiten bei wichtigen Telefonaten und Mails immer mit Verschlüsselungen und treffen Informanten bei besonders brisanten Themen an geheimen Orten. Denn eines ist klar: Das oberste Gebot des Spiegel ist und bleibt der Schutz unserer Quellen.
Wie schaffen Sie es, einen Informanten dazu zu bringen, sich Ihnen zu offenbaren?
Ganz wichtig ist es, ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Informanten aufzubauen. Das geht immer auch über das Geben und Nehmen von Informationen. Außerdem ist die Vorbereitung auf ein Gespräch nicht zu unterschätzen. Sie sollten hundertprozentig im Thema sein und dem Informanten damit zeigen, dass Sie der richtige Ansprechpartner sind.
Da wird zwar auch immer noch geschmiert, aber es wird trickreicher und professioneller gemacht.
Dem Thema Sport haben Sie sich in den letzten Jahren ganz intensiv gewidmet. Da gibt es die Berichterstattung über die WM 2016, das Sommermärchen, und jetzt zuletzt als Resultat der internationalen Kooperation, die Geschichten über Ronaldo und Messi und deren Steueraffäre. Wenn man in diese Welt des Sports abtaucht, braucht es dann noch mal andere Recherchemethoden?
Sport und gerade der Fußball werden für investigative Journalisten immer interessanter. Es geht nicht mehr nur um die 1:0-Berichterstattung. Heute werden Geschichten über Doping, Wettbetrug oder Sportpolitik immer wichtiger. Und hier ist gute Recherche gefragt. Oder nehmen sie den Fußball. Da wird immer mehr Geld reingepumpt, weil die Fernsehrechte immer teurer werden und weil es mittlerweile Scheichs und Oligarchen gibt, die darin eine Chance sehen, Geld zu waschen. Damit gibt es auf der einen Seite zwar eine wahnsinnige Professionalisierung. Auf der anderen Seite herrschen aber in den Verbänden noch immer Strukturen vor, die oftmals an einen Dorfverein erinnern und durch Kungelei und Korruption geprägt sind. Dadurch machen die Betroffenen offensichtlichere Fehler, die sich leichter aufdecken lassen. Das sind Themen die jeden Rechercheur faszinieren, egal ob er sportbegeistert ist oder nicht. Dagegen wird die Enthüllung von Wirtschaftsskandalen tendenziell schwerer. In großen Konzernen gibt es mittlerweile Berater, die nur dafür engagiert sind, sich große Firmenkonstrukte auszudenken, um Geldflüsse zu verschleiern. Da beißen Sie sich häufig die Zähne aus. Und: Die großen Konzerne haben nach der Siemens-Korruptionsaffäre vor zehn Jahren eindeutig dazu gelernt. Da wird zwar auch immer noch geschmiert, aber es wird trickreicher und professioneller gemacht.
Kommen wir zur letzten Frage: Sie haben zuletzt über den Weißen Ring in Lübeck berichtet. Der Chef des Opferhilfevereins soll Hilfe suchende Frauen sexuell belästigt haben. Dabei haben Sie den vollen Namen des Beschuldigten genannt, während das in einem anderen Fall bei Belästigungsvorwürfen beim WDR zum Beispiel nicht der Fall war. Wo liegt da der Unterschied?
Darüber haben wir auch lange Zeit mit unseren Juristen diskutiert. Wir sind letztlich zu der Überzeugung gekommen, dass wir den Namen nennen können. Die Beleglage war schon erdrückend. Und wir hatten ja gut ein Dutzend Fälle. Und selbst wenn wir den Namen nicht genannt hätten, wäre es in Lübeck und Umgebung jedem klar gewesen, wer gemeint ist. Der Vorsitzende des Weißen Rings ist bekannt wie ein bunter Hund und somit haben wir uns dazu entschieden, den vollen Namen zu nennen.
Das Interview führte Message-Herausgeber Volker Lilienthal; Redaktion: Jan-Niklas Pries

Recherchen zwischen Leipzig, Lagos und New York. Wie ein internationales Team nigerianischer und deutscher Journalisten die schwierige Geschichte afrikanischer Beute-Kunst recherchierte.
von John Eromosele und Lutz Mükke
Der alte Mercedes Benz stand inmitten eines reißenden, braunen Wasserstroms. Draußen ging nichts mehr. Gigantische Wolkenbrüche hatten die Stadt binnen einer Stunde in ein System von Wasserstraßen verwandelt. Wo gerade noch die Fahrbahn zu sehen war, floß jetzt an vielen Stellen knietiefes Wasser. Große Kreuzungen und kleine Schleichwege – alles war blockiert, überall waren Autos abgesoffen. Zu versuchen, weiter Richtung Flughafen zu kommen, machte keinen Sinn. Tapfer kämpfte die Klimaanlage des angerosteten Benz‘ mit der tropischen Schwüle um die Lufthoheit. Welcome to Benin-City, Nigeria.

Die geraubten Bronzen erzielen auf dem Kunstmarkt Millionensummen und werden in renommierten Museen wie im Metropolitan Museum of Art in New York ausgestellt.
Uns blieb nur das, womit Afrika so verschwenderisch umgeht: Zeit und Warten. Egal, die Stimmung war so gut wie die Story, die es zu recherchieren galt. Benin-City, einst Hauptstadt des mächtigen westafrikanischen Königreichs Benin, liegt heute im südlichen Nigeria, nicht zu verwechseln mit dem Staat Benin. Die Briten setzten der Unabhängigkeit des Königreichs mit einer gnadenlosen Militärinvasion 1897 ein jähes Ende. Sie töteten Tausende, brannten Dörfer, Paläste und die Hauptstadt nieder und plünderten 3.500 bis 4.000 Bronzereliefs, geschnitzte Elfenbeinstoßzähne, Kopfplastiken, Terrakotten, Holzschnitzereien. Zur Refinanzierung des Krieges versteigerte man die sakralen Objekte und Kunstgüter, die einen enormem kulturellem Wert besitzen, dann in London. Heute sind sie in vielen westlichen Völkerkundemuseen ausgestellt. Der internationale Kunstmarkt erzielt mit ihnen Höchstpreise, bereits Einzelstücke kosten Millionen. Der komplette Schatz hat heute einen geschätzten Wert von einer halbe bis eine Milliarde Euro. Seit Jahrzehnten stehen Restitutionsforderungen aus Nigeria im Raum. Die Frage war: Wie gehen neue und alte Besitzer des Benin-Schatzes heute mit diesem schwierigen kolonialen Erbe um?
Auf den Spuren des Kunstschatzes führte uns die Recherche binnen fünf Monaten unter anderem nach London, Lagos, Wales, Berlin, New York, Hamburg, Cambridge, Leipzig, Boston, Dresden – und zwei Mal nach Benin-City, wo besagte Regenflut uns zwischen zwei Interviewterminen zum Warten zwang. Im Benz saßen vier der fünf Kollegen, die an der grenzübergreifenden Recherche beteiligt waren: Maria Wiesner, Emmanuel Ikhenebome und die beiden Autoren dieses Berichts. In Lagos, Nigerias großer Boom-Stadt, hatte zudem Journalistenkollege Eromo Egbejule kooperiert.
Recherchejournalismus ist oft aufwändig. Je heikler eine Story ist, desto länger braucht es, wichtige Quellen davon zu überzeugen, ein Interview zu geben. Die Annahme, dass das bei der Benin-Bronzen-Recherche anders sein würde, weil sie zum Großteil im liberal aufgeklärten Kultur- und Museumsmilieu spielt, erwies sich rasch als grobe Fehleinschätzung.
Ein paar Beispiele: Monatelange Bemühungen um ein Interview mit dem Direktor des Britischen Museums in London – dem Ort, wo heute die meisten Benin-Bronzen sind – verliefen zäh und letztlich im Nichts. Eine andere sehr wichtige Quelle wollte vor dem Gespräch “einen fetten Briefumschlag” und die Botschaften Nigerias in Berlin (wichtig für Visa) und die Deutschlands in Nigeria (wichtig für ein gefordertes Empfehlungsschreiben) stuften das Kunstraub-Thema gleich als “politisch” ein, was teils erneut wahre Kommunikationsschlachten nach sich zog. Plötzlich war sogar das Auswärtige Amt in Berlin mit unserer Benin-Bronzen-Recherche befasst.
Neben viel Zeit geht Recherchejournalismus oft auch mit hohem finanziellen Aufwand einher. Selbst wenn man in Hotels der “Kategorie Kakerlake” absteigt, tagelang die Couch von Freunden okkupiert oder hunderte Kilometer mit dem Minibus über Nigerias Straßen holpert, um Kosten zu sparen: Um nach Nigeria, in die USA, nach Großbritannien und in Deutschland zu reisen, braucht es viel Geld. Das Reisen an die Orte des Geschehens bleibt jedoch auch in Zeiten von Skype und WhatsApp fundamental notwendig. Zum einen ist es für eine saubere journalistische Arbeit oft viel ergiebiger, Quellen und Orte persönlich in Augenschein zu nehmen. Zum anderen reden Gesprächspartner wie die Mitglieder der königlichen Familie in Benin-City (westafrikanischer Hochadel) über das Kulturerbe ihres Landes und ihre Rückgabeforderungen sowieso nur, wenn man ihnen gegenüber sitzt.
Wer die aufwendige Benin-Bronzen-Recherche bezahlte? – Wohl keine deutsche Redaktion hätte für diese Recherche Reisekosten in fünfstelliger Höhe bereitgestellt. So viel Geld braucht es aber für Flüge, Unterkunft, Transport, Kommunikation, monatelanges Reisen. Eine alternative mögliche Geldquelle sind Recherche-Stipendien, um die sich Journalisten bewerben können. Eines der höchstdotierten und entsprechend begehrten deutschen Stipendien ist das „Kartographen-Mercator-Stipendienprogramm” vom deutschen Journalistenverein „Fleiß und Mut“. Eine Jury erfahrener Journalisten u.a. von Spiegel, Zeit, ARD und ORF entscheidet über eingereichte Projektanträge. Der Antrag des Projektleiters überzeugte und gewann eine Fördersumme, die das gesamte Unterfangen ermöglichte: Recherchen auf drei Kontinenten mit ca. 80 Interviews und Hintergrundgesprächen. Veröffentlicht wurden – und werden – die Rechercheergebnisse in Beitragsserien bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Leipziger Volkszeitung, im Guardian Nigeria und im Nigerian Observer. Die optische Umsetzung durch das FAZ-Team in den Storytellings auf FAZ.net war eine besondere Leistung.
Für den Erfolg der Arbeit war die enge deutsch-nigerianische Kooperation essentiell. Via WhatsApp and Email sprachen wir miteinander, tauschten Informationen und Dokumente aus. Die Autoren des Artikels erstellten bspw. eine Liste mit nigerianischen Interviewpartnern: Würdenträger, hochrangige Politiker, Akademiker, Aktivisten, Superstars der Kunstszene, Museumskuratoren. Die meisten der Gesprächspartner wollten vorab genau über die Recherchen informiert werden, mit offiziellen Anfragen aus Deutschland und oft noch mit einem persönlichen Vorgespräch. Während eines fünf Wochen langen konzentrierten Kommunikations-Ping-Pongs zwischen Deutschland und Nigeria füllte sich der Terminkalender für die erste Nigeria-Reise peu á peu. Da half nur Geduld, Ausdauer und viel Humor. Überraschenderweise war es unkompliziert, den Termin mit dem viel beschäftigten Ministerpräsidenten des Bundesstaates Edo Godwin Obaseki zu bekommen. Er wollte das Treffen unbedingt. Das Thema hat für ihn höchste Priorität. Ähnliches gilt für den nigerianischen Botschafter in Berlin Yusuf Maitama Tuggar. Auch das Königshaus in Benin, das die Restitutionsansprüche stellt, war interessiert. Gleichwohl bedurfte es, um den Interviewtermin mit Eduware II, dem König von Benin, zu bekommen, ähnlicher Ausdauer, wie wenn man den König von Spanien oder Schweden interviewen möchte.
Einen Monat nach dem stundenlangen Warten im alten Benz im schwül-tropischen Unwetter Nigerias, stand ein Interviewtermin im winterlich kalten New York an, im Metropolitan Museum of Art. Eine weltbekannte amerikanische Museumskuratorin stieg äußerst forsch ins Gespräch ein: Weshalb denn ausgerechnet eine Benin-Bronzen-Story? Das sei doch „ganz langweilig“ und ein „alter Hut.“ – Für einen kurzen Moment waren wir perplex. Dann kam uns ein Gedanke: Getroffene Hunde bellen. In Nigeria sieht man das ganz anders.
Von Krieg, Plünderung und der traurigen kolonialen Vergangenheit war in der Benin-Ausstellung dieses weltberühmten New Yorker Museums übrigens nichts zu lesen. Geschweige denn von Restitutionsansprüchen.
John Eromosele arbeitet für die Organisation Code for Nigeria und bildet dort unter anderem Journalisten im Daten-Journalismus aus. Er plante und organisierte die Recherchen in Benin-City maßgeblich mit.
Lutz Mükke, Journalist und Afrikanist aus Leipzig und international erfahrener Medienmanager, verfolgte diese Geschichte seit mehr als 20 Jahren. Der Message-Herausgeber initiierte und leitete das Benin-Bronzen-Projekt. Kontakt: lutzmuekke@web.de