#nr21 | Dokumentation | Fernsehen
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser? (1. Juli 2021)



Für eine Journalistin oder einen Journalisten sind nur zwei Katastrophen denkbar:
Erstens: Man tut einem unschuldigen Menschen Unrecht an, mit falscher oder irreführender Berichterstattung.
Zweitens: Man gibt eine Quelle preis, die sich darauf verlässt, anonym zu bleiben.
Quellen sind für uns das A und O. Unsere Arbeit speist sich aus ihnen.
Es wäre irreführend zu sagen, Quellen seien das Kapital der Journalisten – Kapital ist etwas, das man ausgibt, worüber man verfügt. Aber Quellen sind Menschen. Über sie verfügt man nicht. Man pflegt ein Vertrauensverhältnis zu ihnen. Man weiß, dass sie sich einem ausliefern. Deswegen ist man verpflichtet, sie zu schützen. Man hütet sie wie das eigene Auge.

„Quellen sind nicht immer einfach“, sagt SZ-Investigativjournalist Nicolas Richter. Aber: „Hinhängen darf man sie auf keinen Fall.“ © DW/R. Oberhammer CC BY-NC-ND 2.0
Quellen sind nicht immer einfach. Sie können Motive haben, die man nicht ausschließlich edel findet. Eine Quelle kann jemandem etwas heimzahlen wollen. Sie kann eine Bühne zur eigenen Profilierung suchen, sie kann Bestätigung darin suchen, dass sie andere zu Fall bringt. Sie kann ungeduldig sein, sie kann leichtsinnig sein. Sie kann sogar versucht sein, Gegner in eine Falle zu locken.
Wie auch immer man zu Motiven und Auftreten seiner Quellen steht: Hinhängen darf man sie auf keinen Fall.
Es ist ein anerkanntes Prinzip in Ländern mit freier Presse, dass Reporter ihre Quellen niemals offenbaren. Eine Ausnahme ist allenfalls in extrem seltenen Ausnahmefällen denkbar, wenn etwa Menschenleben auf dem Spiel stehen.
Es gibt Quellen, die alles daran setzen, im Verborgenen zu bleiben. Es gibt Quellen, die vor alle Weltöffentlichkeit treten, Edward Snowden zum Beispiel.
Snowden lebt seit Jahren im Moskauer Exil, er wird vermutlich nie in seine amerikanische Heimat zurückkehren können, weil ihm dort Strafverfolgung droht.
Er hat für seinen Akt der Aufklärung einen hohen Preis bezahlt.
Immerhin: Er hat diese Entscheidung selbst getroffen.
Nehmen wir an, ein Journalist hätte Snowdens Identität versehentlich verraten und Snowden hätte deswegen ins Exil fliehen müssen – wäre dies nicht ein furchtbares berufliches Versagen gewesen?
Es gibt verschiedene Ebenen, auf denen Quellenschutz ansetzen kann.
Es gibt langjährige, erfahrene Quellen, sagen wir, in einem Ministerium, in einer Firmenzentrale. Es gibt aber auch unerfahrene. Jemand, der einen Missstand miterlebt und zum ersten Mal überhaupt das Gespräch mit einem Journalisten sucht. Jemand, der nicht genau überblicken kann, worauf er sich einlässt. Hier kann es sein, dass man als Journalist der erste Ansprechpartner ist und damit auch Berater. Man muss aufklären über Fragen wie: Soll die Quelle öffentlich auftreten oder unerkannt bleiben? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auffliegt? Kann sie gefeuert werden? Muss sie untertauchen? Lohnt sich das Risiko überhaupt für das, was sie tatsächlich zu enthüllen hat.
Hier ist es wichtig, ganz und gar ehrlich zu sein: Bloß weil ich als Journalist die Story machen will, sollte ich die Folgen für die Quelle nicht kleinreden. Die Quelle schützt man auch, indem man ihr misstraut: Ihre Informationen sollten mit gesunder Skepsis betrachtet und wo möglich überprüft werden. Als Journalist stellt man sich dabei folgende Fragen: Ist das Material authentisch? Ist es vollständig? Welche Interessen stehen hinter dieser Veröffentlichung?
Hier gelangt man schon in einen ersten Grenzbereich. Nehmen wir an, eine Quelle redet über das Organisierte Verbrechen oder über Machenschaften in einem Geheimdienst. Es könnte sein, dass die Quelle untertauchen muss, sich verstecken muss, oder, weniger dramatisch, einen Rechtsanwalt braucht, der sie verteidigt gegen eine Kündigung oder Klagen auf Schadenersatz oder gar vor dem Staatsanwalt.
Wir sind hier in der Pflicht aufzuklären, zu beraten, zu unterstützen. Aber es ist für uns irgendwann auch ein Dilemma: Wir zahlen nämlich grundsätzlich kein Geld an Informanten, zahlen in der Regel also auch keinen Anwalt für sie. Wir können zwar mithilfe unserer Justitiare im Verlag erste Ratschläge geben, aber für eine langfristige anwaltliche Betreuung müssen andere einspringen. Es gibt NGOs zum Schutz von Whistleblowern, die Hilfe anbieten, wir können an diese Organisationen vermitteln, aber nicht deren Rolle übernehmen.
Jeder erinnert sich an den Watergate-Film: Deep Throat im Parkhaus. Mitten in der Nacht tritt jemand mit einem Hut hinter einer Säule hervor. Heute kann man mit seinen Quellen elektronisch kommunizieren. Das hat Vorteile und Nachteile. Der Vorteil: Große Datenmengen lassen sich schnell und einfach übertragen. Der Nachteil: Elektronische Kommunikation hinterlässt Spuren, es lässt sich nachverfolgen, wann jemand einen USB-Stick in einen Computer gesteckt hat, um Daten mitzunehmen, es lässt sich nachverfolgen, wenn jemand übers Netz Informationen verbreitet.
Die technischen Herausforderungen des investigativen Journalismus sind so stark in der Vordergrund gerückt, dass sich manche Journalisten-Handbücher wie technische Gebrauchsanleitungen lesen. Eine Gruppe Journalisten hat jüngst einen Leitfaden veröffentlicht mit dem Namen „Perugia Principles for Journalists Working with Whistleblowers in the Digital Age“.
Zitiert wird der Reporter James Risen mit den Worten:“We’re being forced to act like spies, having to learn tradecraft and encryption and all the new ways to protect sources. But we are not an intelligence agency. We’re not really spies. So, there’s going to be a time when you might make a mistake or do something that might not perfectly protect a source. This is really hard work. It’s really dangerous for everybody.” (Wir sind keine Spione, sehen uns aber gezwungen, wie Spione zu arbeiten.)
Das beschreibt die Lage treffend.
Die Organisation Intercept hat sich zum Beispiel Vorwürfen ausgesetzt, sie habe den US-Behörden durch Ungeschick dabei geholfen, eine Quelle ausfindig zu machen. Es ging um eine Frau namens Reality Winner, die dem Intercept offenbar geheime Unterlagen zur Verfügung gestellt hatte. Das wäre tatsächlich eine verheerende Panne. Unter anderem sollen Details in den durchgestochenen Dokumenten die Quelle verraten haben. Es empfiehlt sich daher, Dokumente nicht im Original zu zeigen, allein schon wegen der Metadaten, die verraten können, wer ein Dokument angelegt oder gedruckt hat.
Wir bei der SZ und anderen investigativ arbeitenden Redaktionen rüsten also auf: Für den Erstkontakt bieten wir auf unserer Website einen sicheren Digital-Briefkasten namens SecureDrop, über den Informanten verschlüsselt mit uns kommunizieren können. Wir klären Quellen darüber auf, wie sie Kontakt aufnehmen können. Wir verwenden für unsere interne Kommunikation verschlüsselte Chatgruppen und E-Mails.
Insgesamt steht die Presse hier vor schnell wachsenden Herausforderungen. Die massive Verbreitung von Überwachungstechnologien und einem immer weiter verschärften Polizeirecht schränken weltweit die Freiheit ein, die die Presse braucht.
Quellen klären wir über diese Problematik auf, und manchmal empfehlen wir dann auch mal ein Treffen nach guter altmodischer Art – vielleicht nicht in der Parkgarage, aber vielleicht im Park oder, im Winter, irgendwo, wo es warm ist.
Nicht zuletzt müssen wir unsere Quellen vor dem Staat schützen, vor einer der mächtigsten Organisationen überhaupt. In den USA sind in den vergangenen Jahren immer wieder Menschen verfolgt worden, weil sie Informationen herausgegeben hatten. Nicht Journalisten, sondern deren Quellen. Verfolgt werden dann Verstöße gegen Geheimhaltungsvorschriften oder die Nationale Sicherheit, speziell gegen das Anti-Spionage-Gesetz. Auch Wikileaks-Gründer Julian Assange wird jetzt wegen möglicher Verstöße gegen das Anti-Spionage-Gesetz verfolgt, was eindeutig unverhältnismäßig ist.
Wir Journalisten können das trotz gründlicher Arbeit nicht immer verhindern. Aber wir müssen über solche Fälle ausführlich und kritisch berichten.
Und wir müssen auch hier in Deutschland dem Gesetzgeber streng auf die Finger schauen. Ein Beispiel war das noch recht junge Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Dem Namen nach schützt es grundsätzlich Geheimnisse, aber es beinhaltet auch, zum ersten Mal überhaupt im deutschen Recht, einen Schutz für Whistleblower.
Im Gesetzentwurf war dieser Schutz allerdings nicht ausreichend, erst eine verbreitete öffentliche Kritik der Presse bewegte den Bundestag zu Nachbesserungen.
Es gibt jetzt in Deutschland mehr Schutz gegen strafrechtliches oder zivilrechtliches Vorgehen gegen Quellen und Whistleblower, aber der muss noch verbessert werden. Als Nächstes muss die Bundesregierung die neuen Vorgaben aus Brüssel zum allgemeinen Whistleblower-Schutz umsetzen.
Diese Entwicklung ist wichtig: Sie zeigt, dass der Whistleblower, aber auch die anonyme Quelle im öffentlichen Bewusstsein angekommen sind. Es zeigt ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass Whistleblower einen nützlichen, ja essenziellen Dienst leisten für die Gesellschaft, für die Demokratie. Sie decken Missstände auf, sie bringen Licht ins Dunkel, sie schaffen ein öffentliches Bewusstsein für unerkannte Probleme, für Korruption, für Machtmissbrauch.
Deswegen ist es so wichtig, dass Quellenschutz nicht mehr Sache der Journalisten allein ist.
Quellenschutz ist eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft.
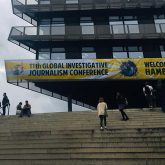
von Julia Behre
Datafizierung, Desinformation, unzureichende Finanzierungsmodelle: Im digitalen Zeitalter muss sich der investigative Journalismus einer Vielzahl neuer Herausforderungen stellen. Diskutiert wurden diese auf der 11. Global Investigative Journalism Conference (GIJC) vom 25. bis zum 29. September in Hamburg, auf der 1.700 investigative Journalisten aus 130 Ländern zusammenkamen. Von den mehr als 250 Panels, Workshops und Meetings hatte dabei ein Viertel aller Veranstaltungen einen inhaltlichen Bezug zum Datenjournalismus, erläuterte das Global Investigative Journalism Networks, das die Konferenz gemeinsam mit Netzwerk Recherche und der Interlink Academy for International Dialog and Journalism veranstaltet hat. Einen inhaltlichen Schwerpunkt bildeten dabei auch Umweltthemen. So ist der Klimawandel nicht nur eines der wichtigsten und drängendsten Themen des 21. Jahrhunderts, er vereint auch viele der auf der Konferenz diskutierten Herausforderungen und Entwicklungen im investigativen Journalismus.

Der norwegische Joournalist Amund Trellevik (r.) warnt vor Ermüdungserscheinungen beim Publikum. / Foto: Raphael Hünerfauth
Das betrifft zunächst die journalistische Beziehung zum Publikum. Laut wissenschaftlichen Untersuchungen des Media and Climate Change Observatory (MeCCO) erreichte die mediale Aufmerksamkeit zum Klimawandel im September 2019 das höchste Level seit fast einem Jahrzehnt. In Deutschland nahm die Berichterstattung im Vergleich zum Vormonat August sogar um mehr als ein Viertel zu. „Doch die Herausforderung dabei ist, dass Menschen eines solchen Journalismus überdrüssig werden können“, sagte der norwegische Journalist Amund Trellevik auf der GIJC. Bei der norwegischen Zeitung High North News beschäftigt er sich mit den Auswirkungen des Klimawandels in der Antarktis. Um die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen und insbesondere Klimaleugnern die Stirn zu bieten, sind laut Trellevik neue Quellen und Blickwinkel im investigativen Klima-Journalismus gefragt.
Zunächst müssten sich Journalisten auf die wissenschaftlichen Fakten zum Klimawandel stützen, betonte in Hamburg James Fahn, Geschäftsführer des Earth Journalism Network, einer globalen Initiative zur Förderung des Umweltjournalismus in Entwicklungsländern. Klima-Journalisten sind Fahn zufolge daher immer auch Wissenschaftsjournalisten, weshalb wissenschaftliche Kenntnisse schon in der journalistischen Ausbildung vermittelt werden sollten. Jedoch sei der Klimawandel nicht nur ein Umwelt- und Wissenschaftsthema, sondern immer auch ein

Wer fundiert über den Klimawandel berichten möchte, muss nach Ansicht von James Fahn neben dem Umweltaspekt auch gesundheitliche, soziale, politische, wirtschaftliche und rechtliche Fragen im Blick haben. / Foto: Raphael Hünerfauth
gesundheitliches, soziales, politisches, wirtschaftliches, rechtliches und internationales, sagt Fahn, der seit mehr als 30 Jahren zum Klimawandel recherchiert. Relevante Themenfelder mit Bezug zum Klimawandel seien etwa die fossile Energiewirtschaft und andere umweltverschmutzende Industrien, Forst- und Landwirtschaft, Ernährung, Verkehrswesen, Zement- und Schwerindustrie und Immobilienwirtschaft. Darüber hinaus müssten investigative Journalisten die unerwarteten und weniger behandelten Folgen des Klimawandels noch stärker beleuchten, wie beispielsweise die Auswirkungen auf das Gesundheitswesen, den Anstieg des Grundwasserspiegels oder zunehmende Migration. Auch Klimaaktivistengruppen und Wissenschaftler müssen laut Fahn stärker in den Fokus investigativer Recherchen gerückt werden. In Anlehnung an den Konstruktiven Journalismus sollten investigative Journalisten dabei stets auch Lösungen für den Klimawandel bereitstellen. Das betreffe Maßnahmen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes, aber auch menschliche Anpassungen an die Folgen des Klimawandels: Wie kann auch zukünftig sauberes Trinkwasser zur Verfügung gestellt werden? Wie können Privateigentümer und öffentliche Infrastrukturen vor Naturgewalten wie Feuer und Wasser geschützt werden? Und welche Methoden des Geoengineerings erweisen sich als wirksam?
Fast jedes Thema kann aus verschiedenen Perspektiven erzählt werden. Martha Mendoza, investigative Journalistin bei der Associated Press (AP) und zweifache Gewinnerin des Pulitzer-Preises, veranschaulichte auf der GIJC in Hamburg, wie investigative Journalisten über Waldbrände berichten können, „ohne immer und immer wieder die gleiche Geschichte zu erzählen“. Im Vorfeld könnte z.B. datenjournalistisch untersucht werden, welche Gemeinden am stärksten von zukünftigen Waldbränden bedroht seien, da bin den USA immer mehr Wohnhäuser in Wäldern oder angrenzenden Gebieten gebaut werden würden. Wie wirkt sich die damit verbundene Rauchbelastung auf die öffentliche Gesundheit aus? Und wie können Häuser vor zukünftigen Bränden geschützt werden, etwa durch feuersichere Dächer? Während des Ereignisses könnte der Prozess der Evakuierung tiefer beleuchtet werden, malte Mendoza aus: Wer ist für die Evakuierung zuständig? Und unter welchen Bedingungen arbeiten diese Menschen? Bei der Nachberichterstattung wird es der AP-Journalistin zufolge erst richtig spannend, denn dann wird das Ausmaß der wirtschaftlichen und sozialen Kosten eines Brandes deutlich. Hier könnten investigative Journalisten beispielsweise untersuchen, wie Opfer entschädigt werden und wie die Aufräumarbeiten ablaufen. Nicht zuletzt müsse auch den Ursachen des Brandes auf den Grund gegangen werden.

Die Datenjournalistin Madeleine Ngeunga aus Kamerun rät Kollegen, den Lesern klarzumachen, wie der Klimawandel deren Leben direkt beeinflusst. / Foto: Raphael Hünerfauth
Um die Auswirkungen des Klimawandels für die Leser greifbarer zu machen, ist ein noch stärkerer Fokus auf den Menschen notwendig. „Wir hören oft in der internationalen Berichterstattung, dass wir die Wälder und die natürlichen Ressourcen schützen sollen, aber wir sprechen nicht über die Lebensgemeinschaften, die diese Ressourcen auch beschützen wollen“, kritisiert Madeleine Ngeunga. Als Datenjournalistin recherchiert die Kamerunerin zu Umweltthemen und Menschrechten für die regionale Nachrichtenwebseite InfoCongo. Investigativer Journalismus in Afrika solle auf lokale Gemeinschaften achten, die in den vom Klimawandel bedrohten Gebieten leben und beispielsweise mit zunehmend begrenzten natürlichen Ressourcen zu kämpfen haben. Anderen Journalisten rät Ngeunga, direkt mit dem Publikum zu interagieren und einen direkten Zusammenhang herzustellen, wie der Klimawandel dessen Leben verändert.
Datenjournalistische Inhalte dominierten die Hamburger GIJC – so auch im Hinblick auf die Klimakommunikation. Aufgrund der Komplexität des Themas müssten investigative Journalisten auf ein großes Ausmaß an Daten zurückgreifen, berichtete der investigative Fotojournalist Eduardo Franco Berton.

Fotojournalist Eduardo Franco Berton nutzt interaktive Karten und Satellitenbilder als Ergänzung zu seiner Berichterstattung. / Foto: Raphael Hünerfauth
In seiner Umweltberichterstattung über Waldbrände in Lateinamerika verwendet er beispielsweise interaktive Karten. Um die Auswirkungen der Waldzerstörung durch den Klimawandel verdeutlichen zu können, greift er über Online-Tools auf Echtzeitdaten zurück. Über Satellitenbilder können Leser die Waldbrände ebenfalls in Echtzeit verfolgen. Und für ihre Berichterstattung zu Waldbränden in den USA analysiert die AP-Journalistin Mendoza Tracking-Daten von Löschflugzeugen, um zu beobachten, wo die Flammen zuerst gelöscht wurden – etwa beim Haus des Bürgermeisters oder des Oberbrandmeisters? All diese Tools sind laut Berton aber nicht nur für investigative Journalisten hilfreich, sondern ermöglichen auch eine aktuelle Berichterstattung über Umweltthemen wie Hitzewellen und Brände im alltäglichen Nachrichtengeschäft. Um die Aufmerksamkeit des Lesers zu gewinnen, komme es jedoch auf die Visualität des journalistischen Produkts an: „Daten sind sehr wichtig. Aber wenn man sie mit tatsächlicher Fotografie kombiniert, ergibt das eine wirklich mächtige Geschichte“, sagt Berton.
Social Networking und kollaborativer Journalismus bildeten einen weiteren wichtigen Konferenz-Schwerpunkt, der ebenfalls für die Klimakommunikation von hoher Bedeutung ist. Denn investigative Recherchen zu umweltbezogenen Themen müssten sich sehr häufig gegenüber Korruption und Machtkämpfen behaupten, was oftmals mit einem erschwerten Informationszugang verbunden sei, berichtet Laurent Richard, der seit mehr als 20 Jahren als investigativer Dokumentarfilmer arbeitet. Besonders in Ländern mit eingeschränkter Pressefreiheit könnten Kollaborationen aber auch Schutz bieten. Laut dem Committee to Protect Journalists wurden seit 2009 mindestens 13 Journalisten getötet, die an umweltbezogenen Geschichten arbeiteten. „Wenn ein Journalist für eine Geschichte getötet wird, dann liegt das daran, dass sie sehr wichtig für die öffentliche Meinung ist“, sagt Richard.
Aus diesem Grund hat er die Non-Profit-Organisation Forbidden Stories gegründet, um die Recherchen von bedrohten Journalisten aus aller Welt weiterzuführen. In ihrem Projekt Green Blood verfolgte das kollaborative Recherchenetzwerk gemeinsam mit 15 Medienpartnern aus aller Welt die Ermittlungen mehrerer Reporter, die bei der Aufdeckung von Umweltschäden und anderen Missbräuchen durch Bergbauunternehmen in Guatemala, Tansania und Indien Bedrohungen ausgesetzt waren. Doch auch in demokratisch geprägten Ländern ist die Zusammenarbeit unter Journalisten laut dem norwegischen Reporter Trellevik mittlerweile für die eigene Sicherheit unverzichtbar, denkt man etwa an die zunehmenden Angriffe auf Medien von Seiten von Politikern und des Publikums. „Es besteht keinen Zweifel: Ohne Kooperation im Journalismus kannst du nicht überleben“, sagt Trellevik. „Eine globale Krise erfordert eine globale Berichterstattung.“

von Volker Lilienthal und Journalistik-Studierenden der UHH
„Alles, was ich erzähle, ist erfunden.
Einiges davon habe ich erlebt.
Manches von dem, was ich erlebt habe,
hat stattgefunden.“
Matthias Brandt: „Raumpatrouille“
Nicht nur der Spiegel ist eine betrogene Redaktion. Bekanntlich brachte Claas Relotius seine Lügengeschichten in vielen Zeitungen und Zeitschriften unter. Unter den Betroffenen ist auch die Financial Times Deutschland (FTD). Bislang hatte niemand die dort zwischen August 2010 und April 2012 erschienenen zehn Beiträge verifiziert. Eine Redaktion, die das tun könnte, gibt es ja nicht mehr. Auch der Verlag Gruner + Jahr kam nicht auf die Idee. Das Blatt wurde am 7. Dezember 2012 eingestellt. Sein Chefredakteur war von 2004 bis zum Ende Steffen Klusmann, der heutige Spiegel-Chefredakteur.

Lange hatte sich die Hamburg Media School mit Claas Relotius geschmückt. Auch nach Bekanntwerden der Fälschungsvorwürfe gegen den HMS-Absolventen hieß es noch wochenlang auf der Website der Hochschule, er habe auch für den Guardian in London gearbeitet – auch das: widerlegt. Jetzt heißt es auf der HMS-Website in der Rubrik „Köpfe“ allgemeiner: „Texte von Claas Relotius sind sowohl in deutschsprachigen als auch in englischsprachigen Publikationen erschienen.“
Die zehn FTD-Texte fanden sich in der Genios-Pressedatenbank. Das ausstehende Fact-Checking haben nun Journalistik-Studierende der Universität Hamburg nachgeholt. Das Kernergebnis ihrer Überprüfungsrecherchen, angestellt im Masterkurs „Recherche II“, widerlegt eine bei der Ursachenforschung seit Mitte Dezember wiederholt aufgestellte These: Relotius, Spiegel-Redakteur erst seit 2017, habe dem dort herrschenden Leistungsdruck genügen wollen. Zudem hätten die Journalistenpreise, die er bis kurz vor seinem Karriereende ergatterte, falsche Anreize gesetzt.
Die Wahrheit ist eine andere: Schon der frühe Relotius entwickelte schädliche Neigungen, er recherchierte seine Fakten nicht immer sorgfältig, er kupferte manchmal bei anderen ab, und er hübschte seine Storys gelegentlich auf, indem er Vor-Ort-Sein suggerierte und mutmaßlich auch Zudichtungen vornahm. Dies alles zu einer Zeit, als der damalige Mitzwanziger noch an der Hamburg Media School studierte bzw. kurz nachdem er dort Ende 2011 seinen Masterabschluss gemacht hatte.
Die Relotius-Texte erschienen allesamt im Agenda-Teil der lachsfarbenen FTD – einem Zeitungsbuch, in dem damals Kultur, Sport, „Out of Office“, auch Reportagen, Kommentare und Analysen ihren Platz fanden. Keine harten Wirtschaftsgeschichten mit Zahlen und Fakten, sondern bunte Erlebnisberichte, die häufig im „Weekend“ (freitags) ihren Platz fanden. Wie auf Genios dokumentiert, folgte der Relotius-Autorenzeile jeweils eine schillernde Ortsmarke – ganz so, als sei Relotius überall dort gewesen. Metropolen waren darunter – London, Moskau, Berlin und selbst Mexiko-Stadt. Eine norwegische Insel namens Bastøy, auch Bethlehem, Kopenhagen und weniger bekannte Orte wie Akaba, Askar und nicht zu vergessen die Grafschaft Kent im Südosten Englands.
Starten wir in Jordanien und wandern in chronologischer Reihenfolge des Erscheinens nach Norwegen.
In dem Artikel „Die Bassprediger von Akaba“ (04.08.2010) berichtet Claas Relotius über das Distant Heat Festival in Jordanien im Juli 2010. Der Artikel zeichnet ein buntes Bild aus vielen Eindrücken, sodass der Leser das Gefühl hat, selbst vor Ort zu sein. Doch war Relotius tatsächlich Besucher des Festivals? Dies kann durch einige ungenaue Angaben zumindest angezweifelt werden.
So gibt er als Festival-Location die Wüstenlandschaft Wadi Tala an. In verschiedenen anderen Quellen, wie der New York Times (NYT) oder Vice, wird jedoch von Wadi Rum gesprochen. Wadi Rum liegt in der Wüste nahe der Stadt Akaba an einem Ausläufer des Roten Meeres im Süden Jordaniens. Die beiden genannten Artikel weisen des Weiteren darauf hin, dass das Festival wenige Tage vor Beginn nach Akaba verlegt werden musste, da es Beschwerden der Einheimischen gab. Von dieser Verlegung berichtet Relotius nicht, jedoch davon, dass das Festival im Jahr 2010 zum ersten Mal im Wadi Tala stattfand. Wadi Tala ist zu klein, um über Google Maps gefunden zu werden. Lediglich auf einer Webseite über eine Beduinentour ist von einem Wadi Tala in der Nähe („even closer to town“) des „St. Katherine village“ die Rede. Damit ist vermutlich das Katharinenkloster gemeint, welches allerdings zwischen dem Golf von Akaba und dem Suezkanal in Ägypten liegt.
Die Protagonisten des Artikels und ihre Aussagen sind kaum verifizierbar. Zunächst wird ein älterer Beduine vorgestellt. Verwunderlich dabei ist, dass dieser noch nie in seinem Leben einen solchen Lärm gehört haben soll, obwohl das Festival – laut Relotius – bereits seit sieben Jahren in seinem Ort stattfindet. Neben diesem Beduinen und einem Festivalbesucher aus Syrien kommt der deutsche DJ Alex M.O.R.P.H (bürgerlich Alexander Mieling) zu Wort. Dieser trat zwar nachweislich auf dem Festival auf, war aber leider nicht für eine Überprüfung seiner angeblichen Aussage im FTD-Artikel zu erreichen. In der NYT wird der DJ ebenfalls zur Besonderheit der Location zitiert – die beiden Aussagen sind aber nicht identisch.
Relotius schildert auch Probleme, mit denen das Festival zu kämpfen hat. In anderen Artikeln wird ebenfalls darüber berichtet, dass das Festival viele Gegner hat. Ob die jordanische Kulturbehörde das Festival tatsächlich unterstützt und ob in den Anfangsjahren wirklich der Geheimdienst vor Ort war, konnte nicht verifiziert werden. Die Webseite der jordanischen Kulturbehörde – nur auf Arabisch verfügbar – stellt jedenfalls keine Informationen über das Festival zur Verfügung.
Zu bestätigen sind Relotius’ Aussagen über das national und international gemischte Publikum, über die Teilnahme von Fans aus mittlerweile aller Welt. Doch lassen Relotius markante Beschreibungen der Festivalbesucher Zweifel aufkommen: „Sie sind grell geschminkt und haben auftoupierte Haare, Ringe in der Nase oder Trillerpfeifen im Mund.“ Im Beitrag der New York Times wird ein anderes Bild des Festivalpublikums geschildert. Die dort abgebildeten Besucher wirken weniger schrill.
Zusammenfassend können einige Unstimmigkeiten und Abweichungen von anderen Quellen festgehalten werden. Insbesondere die Nennung einer anderen Location ist auffällig. Die Mehrzahl der Aussagen des Artikels ist jedoch nicht verifizierbar, da Quellen aufgrund geographischer, kultureller und zeitlicher Hürden fehlen oder die Protagonisten nicht ausfindig gemacht werden können.
Fact-Checking: Julia Behre, Margarita Ilieva, Theresa Krieger
In dem Artikel „Beat über Bethlehem“ (17.09.2010) berichtet Claas Relotius über das „Cosmos“, den wohl einzigen Tanzclub im Westjordanland. Die Überprüfung seiner im Text getätigten Aussagen hinterlässt dabei einen gemischten Eindruck. Während sich einige problemlos nachprüfen lassen, sind andere schlichtweg nicht verifizierbar.
Viele von Relotius’ Aussagen lassen sich mithilfe einer Internetrecherche schnell überprüfen. So konnte zum Beispiel Peter Hosh, Betreiber des Tanzclubs und hauptsächlicher Protagonist in Relotius’ Text, als ebendieser identifiziert werden: Die Deutsche Welle berichtete ebenfalls über das „Cosmos“ und zeigt ein Foto, auf dem der Clubbesitzer unter Angabe des gleichen Namens zu sehen ist. Ebenso sieht man Peter Hosh auf einem Bild, das auf der Website gettyimages.co.uk käuflich erworben werden kann. Eine Aussage von Relotius, nämlich dass im „Cosmos“ Alkohol an Gäste ausgeschenkt werde, wird durch diese Aufnahme ebenfalls bestätigt: Der Barbesitzer steht vor einem mit Alkoholika gut gefüllten Regal. Dass Hosh diesbezüglich keinerlei Probleme mit den örtlichen Behörden haben soll – so Relotius in seinem Artikel –, thematisiert auch ein Artikel von The Jerusalem Post aus dem Jahre 2007. Bei Hosh selbst erfragt oder aus der Jerusalem Post abgeschrieben – letztlich lässt sich das nicht entscheiden.
Auch Relotius’ Beschreibung der Räumlichkeiten scheint zuzutreffen: Demnach gibt es im „Cosmos” LCD-Schirme, Stroboskoplicht, Nebelmaschinen und Wasserpfeifen. In einem Youtube-Video von 2012 sieht man die Tanzfläche und Fotos von anderen Bereichen des Clubs.
Die Aussage, dass das „Cosmos” der einzige Tanzclub in Palästina ist, ist ebenfalls zutreffend. Es scheint zum Zeitpunkt des Erscheinens des Artikels tatsächlich nur einen richtigen Club, in dem getanzt und gefeiert wurde, in Palästina gegeben zu haben. Es gibt zwar viele Bars und Restaurants, aber keinen Club wie das „Cosmos“. Auch Relotius’ Aussagen über die Bevölkerungsanteile der Religionen in Bethlehem stimmen.
Was ließ sich nicht überprüfen? Relotius schreibt: „Jeden Donnerstagabend legen hier arabische DJs auf.” Da der Club keine eigene Internetseite hat und die Facebookseite nicht mehr existiert, ließ sich diese Aussage nicht überprüfen. Relotius schreibt auch, dass es 2008 in der Stadt Hebron einen Brandanschlag auf ein Konzerthaus eines Freundes von Peter Hosh gegeben habe. Es fanden sich jedoch keine Medienberichte über ein Konzerthaus, das 2008 in Hebron abbrannte.
Zu bemerken sind ferner einige Ungereimtheiten. Relotius schreibt, dass es „mehr als 400 Besucher” seien, die jede Woche im „Cosmos“ feiern gehen. Einen Tag vor Erscheinen des FTD-Artikels hat Relotius jedoch einen Artikel bei der dpa veröffentlicht, in dem er noch von 300 Besuchern schreibt. Im Sommer 2010 hatte Relotius als Praktikant für das dpa-Büro in Tel Aviv gearbeitet und in dieser Zeit laut Nachrichtenagentur drei längere Korrespondentenberichte verfasst. Dazu erklärte Unternehmenssprecher Jens Petersen Message: „Bei den Texten können wir Fälschungen oder erfundene Zitate bisher nicht nachweisen. Wir haben mit in den Berichten genannten Personen Kontakt aufgenommen. Es konnte sich aber keiner der nachprüfbaren Protagonisten an Relotius erinnern. Gleichzeitig gibt es aber Hinweise, dass er zumindest vor Ort gewesen ist.“ Die Berichte wurden vorsorglich gesperrt, der 2012 an Relotius verliehene Nachwuchspreis „dpa news Talent“ (2. Preis) aberkannt.
Nicht nachprüfbar sind die O-Töne von Clubbesuchern, da diese lediglich mit Vornamen, zum Beispiel als “Elina aus Schweden”, benannt werden und somit nicht von uns kontaktiert werden konnten. Clubbesucher Farid schwärmt laut Relotius über blonde Frauen und sucht im Club nach einer Bekanntschaft für die Nacht. Auch Farid konnten wir nicht auffinden, allerdings ist seine Aussage unwahrscheinlich, denn laut einem Artikel von 2007 aus einer israelischen Zeitung werden in das Cosmos nur Paare hinein gelassen und keine alleinstehenden Männer, die Ausschau nach hübschen Frauen halten. In dem israelischen Artikel heißt es: “If you were interested in meeting someone, this wouldn’t exactly be the place.”
Auffällig ist auch, dass sich die O-Töne von Relotius’ Protagonisten in dem dpa-Artikel und dem FTD-Artikel unterscheiden. Auch wenn es nur einzelne Formulierungen sind, deuten diese Unterschiede darauf hin, dass es Relotius nicht ganz genau genommen hat mit den Aussagen seiner Interviewpartner.
Aus unserer Überprüfungsrecherche schließen wir, dass Relotius nicht hätte vor Ort sein müssen, um einen Artikel über das „Cosmos” zu schreiben. Mehrere israelische Medien hatten bereits im Vorfeld über das „Cosmos” berichtet, die Fakten zu Eintrittspreisen, Räumlichkeiten und dem Clubbesitzer ließen sich einfach aus anderen Artikeln übernehmen. Die Protagonisten wurden bis auf den Clubbesitzer so anonymisiert, dass sie für uns nicht auffindbar waren. Vielleicht gibt es sie und Relotius war wirklich vor Ort. Es ist aber auch möglich, dass Relotius sich die Protagonisten ausgedacht hat. Die Formulierungsunterschiede in den O-Tönen im dpa– und FTD-Artikel lassen zumindest vermuten, dass Relotius nicht mit der nötigen journalistischen Sorgfalt gearbeitet hat.
Fact-Checking: David Baldauf, Clara-Franziska Kopiez
Anfang 2011 kann Relotius in der FTD einen Artikel über das palästinensische Flüchtlingscamp Askar unterbringen. Dort konnte man zu der Zeit über eine Organisation, gegründet von Niederländern, Straßenschilder kaufen und sie mit einem eigenen Namen versehen. Das Geld sollte einem Jugendzentrum des Camps zugutekommen. Aber war Relotius wirklich vor Ort? Stimmen die Fakten?
Zu Beginn des Artikels „Das Geld liegt auf der Straße“ (27.01.2011) nennt Relotius einige Straßennamen, die es infolge der Aktion in Askar geben soll. Es ließ sich belegen, dass die jeweiligen Straßennamen zwar tatsächlich genutzt werden, dass sich jedoch bei drei von vier Straßennamen kleine Fehler in der Schreibweise eingeschlichen haben. Der erste Protagonist seines Artikels wird Khalid Ibrahim genannt und soll 61 Jahre alt sein. Er sei einer der wenigen, die Englisch lesen, sprechen und verstehen könnten, heißt es. Diese Beschreibung trifft interessanterweise auch auf einen Ibrahim zu, der in anderen zuvor erschienenen Artikeln (Stuttgarter Zeitung/Deutsche Welle) erwähnt wurde. Dort ist dieser allerdings deutlich über 61 Jahre alt und, anders als bei Relotius, mit einer ausführlichen Hintergrundgeschichte ausgestattet. Es stellt sich also die Frage: Gibt es zwei Menschen im Camp mit dem gleichen Namen, die beide Englisch sprechen, oder ist derselbe Mensch von einem Bericht zum nächsten plötzlich jünger geworden?
Bei der Vorstellung seiner Protagonisten schreibt Relotius weiter: „Zusammen mit einem Freund verkauft der 31-jährige Niederländer die Straßennamen von Askar im Internet“. Das stimmt nur teilweise. Der Niederländer namens Basthios Vloemans ist tatsächlich einer der Beteiligten des Straßenschild-Projekts, er hatte jedoch mehrere Mitstreiter, nicht nur einen. Das zeigt ein Blick auf ihre Website: Dort werden vier Gründer benannt. Wie konnte Relotius dies übersehen? Oder ließ er sich von einer missverständlichen Passage in der Stuttgarter Zeitung inspirieren? „Die Idee kommt aus den Niederlanden, aus Amsterdam. Job van Oel und Basthios Vloeman besuchen auf einer Reise das Flüchtlingslager, sie wollen helfen, doch nicht nur Geld sammeln“‘. Zwar stammt die Idee von zwei Personen, die Schilder wurden aber von vier Personen verkauft.
Zitate, die im Relotius-Artikel erscheinen, ähneln ebenfalls Abschnitten aus früheren Berichten. So zitiert er den Niederländer Vloemans mit den Worten: „Twitternamen, Geburtstagsglückwünsche, alles ist erlaubt. […] Nur bei politischen oder extremen Sachen machen wir nicht mit. Die Namen sollen für etwas Positives stehen.“ In dem Beitrag der Deutschen Welle heißt es ähnlich: „Alles ist erlaubt: Twitternamen, Websites oder Grüße an den Nachbarn – nur extrem darf’s nicht sein.“ Und wiederum in der Stuttgarter Zeitung: „[…] die Schilder sind schön und haben fröhliche Namen.“ In beiden Fällen wurde dort jedoch nicht Vloemans zitiert. Stattdessen handelt es sich einmal um eine Aussage der Autorin selbst und das zweite Zitat wird dem oben genannten Ibrahim zugeschrieben.
Die genauere Recherche konnte keine von Relotius aufgeführten Fakten widerlegen. Es bleibt jedoch unklar, ob er tatsächlich vor Ort war und mit den angegebenen Protagonisten gesprochen hat. Zentrale Elemente seiner Story, wie ein Heiratsantrag mittels eines Straßennamens, sind bereits in vorher erschienenen Artikeln erwähnt worden. Der gesamte Artikel von Relotius besteht aus Fakten, die mithilfe des Internets recherchierbar gewesen wären und theoretisch keine weitere Vor-Ort-Recherche benötigten. Hat Relotius demnach auch bei diesem Artikel betrogen? Die Überprüfungsrecherche lässt es vermuten.
Fact-Checking: Paula Lauterbach, Paul Meerkamp, Natalia Möbius
In dem Artikel „Es war einmal in Mexiko“, erschienen am 11.02.2011, berichtet Claas Relotius vom „Müllpaten“ Pablo Téllez und dessen „Mafia“, die auf dem Bordo Poniente, dem „größten Abfallhaufen Lateinamerikas, regiert“. Tatsache ist: Die Mülldeponie im Osten von Mexiko-Stadt existierte wirklich.
Im Jahr der Artikelveröffentlichung, Ende 2011, wurde sie dann aber geschlossen. Relotius steigt szenisch ein („Der Morgen graut“) und suggeriert damit, er sei als Reporter selbst vor Ort gewesen. Seine Beschreibungen der „600 Fußballfelder großen“ Müllkippe von „Don Pablo“ und seinen „1000 geschätzten Pepenadores“ (dt. Müllmenschen) ähneln aber an zahlreichen Stellen stark der bereits ein Jahr zuvor in der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) erschienenen Reportage von Alex Gertschen. Um die Größe der Deponie zu beschreiben, werden allerdings aus „700 Fußballfeldern“ bei Gertschen „600 Fußballfelder“ bei Relotius in der FTD.
Im weiteren Textverlauf taucht bei Relotius ein Mann namens Fredo auf. Fredo sei 49 Jahre alt und „einer der Ältesten“ Müllsammler auf der Deponie. Fredo kommt mehrmals zu Wort, u.a. mit der Aussage: „Handschuhe kann ich mir nicht leisten.“ In der FTD schreibt Relotius über Fredo: „Seit über zehn Jahren lebt und arbeitet er schon auf Don Pablos Müllkippe.“ Doch vier Monate zuvor hatte Relotius auf ZEIT Online schon einmal über die Müllkippe geschrieben, ebenso auf welt.de: Auch darin taucht Fredo auf, lebt da aber schon seit „über zwölf Jahren“ auf der Deponie. Und das, obwohl der ZEIT Online-Text zeitlich früher erschienen ist.
Dass freie Journalisten ihre Texte mehrfach verwerten, ist normal. Abweichungen zwischen Textversionen aber, zumal wenn sie Zahlenangaben betreffen, machen skeptisch und können nicht nur mit schludrigem Abschreiben von sich selbst erklärt werden. Die ZEIT hat bislang nicht verifizieren können, dass Relotius wirklich vor Ort war, wie sie in ihrem „Glashaus“-Blog berichtet. Auch die interne Nachprüfung durch die WELT hat eher Zweifel als Bestätigungen erbracht.
Der Schweizer Gertschen hatte für die NZZ mehrere Jahre lang aus Mexiko berichtet und war 2012 aus Mittelamerika nach Zürich bzw. Bern zurückgekehrt. Von ihm darf man annehmen, dass er wirklich auf dem Bordo Poniente war. Bei Relotius ist das fraglich. Der Textvergleich FTD/NZZ liefert handfeste Indizien, wonach Relotius bei Gertschen abgeschrieben hat. So berichtet Gertschen von Silvia Mazadiegos, der Buchhalterin von Deponie-Boss Pablo Téllez. Der Schweizer Reporter hatte sie in ihrem kleinen Büro getroffen. Bei Relotius werden aus einer Buchhalterin zwei Sekretärinnen. Und während es bei Gertschen hieß: „Das offene Fenster ihres Büros ist mit einem Gitter versehen, damit die Fliegen draussen bleiben“, macht Relotius daraus: „Die Klimaanlage brummt, durch das Fliegengitter am Fenster dringt der Lärm der Deponie hinein.“
Alex Gertschen will sich nicht festlegen, was womöglich bei ihm abgeschrieben wurde und was Relotius selbst erlebt hat. Ansonsten äußert sich der erfahrene Schweizer Reporter gegenüber Message eindeutig: „Grundsätzlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass jemand, der sich in Mexiko nicht besonders gut auskennt und nicht lokal vernetzt ist, Zugang zum Bordo Poniente erhalten, geschweige denn ein Interview mit Téllez geführt hat.“
Fact-Checking: Leon Löffler
Im Artikel „Du bist Deutschland“ vom 21. März 2011 stellt Claas Relotius das Interview Project Germany des US-Filmemachers Austin Lynch vor. Grundlage des 50-teiligen Dokumentarfilmprojekts sind die Lebensgeschichten von ebenso vielen Personen, die der Regisseur bei seiner Reise durch Deutschland zufällig auf der Straße getroffen hat.
Klaus Münstermann, Luci Lehmann und Neriman aus Lindau sind drei von ihnen. Relotius zitiert Teile ihrer Aussagen in seinem Artikel – und stellt die faktizierbaren Sachverhalte korrekt dar. Bei der näheren Betrachtung fällt jedoch auf, dass Relotius unsauber arbeitet, beispielsweise als er Luci Lehmanns Heimatort mit „Neubrandenburg“ angibt. In dem auf der Website des Interview Project Germany veröffentlichten Videos sagt diese jedoch: „Ich leb‘ jetzt in Rosenow bei Neubrandenburg“. Das Dorf liegt circa 20 Kilometer nordwestlich von der Stadt entfernt. Relotius ist auch in Bezug auf Lynch nachlässig gewesen. Der Filmemacher sei 24 Jahre alt, heißt es in der FTD. Laut Filmdatenbank IMDb (und anderen Quellen) ist er jedoch am 7. September 1982 geboren. Bei Veröffentlichung des Artikels am 21. März 2011 war der Regisseur also bereits 28.
Am 11. März 2011, also zehn Tage vor Erscheinen von „Du bist Deutschland“, veröffentlicht ZEIT Online ein Wortlautinterview, welches Relotius mit Lynch geführt hat und das vermutlich auch die Grundlage für den Artikel in der FTD bildete. Der Filmemacher wirft darin einen persönlichen Blick auf die von ihm porträtierten Menschen und erklärt, was dies seiner Meinung nach über Deutschland aussagt. Auf Relotius‘ Frage, ob er die Menschen im Ost- und Westteil der Republik unterschiedlich wahrgenommen habe, sagt Lynch:
„Es war seltsam: Als wir in den Osten fuhren, schien sich plötzlich eine dunkle Wolke über uns zu legen – es wollte sich einfach niemand mehr interviewen lassen. Wir dachten schon, die Menschen in Ostdeutschland wären möglicherweise wirklich ganz anders als im Rest des Landes. Aber dann trafen wir irgendwo auf einem Bauernhof eine fröhliche, rothaarige Frau namens Heidemarie und wir konnten unseren ersten Eindruck zum Glück wieder über den Haufen werfen. Menschen sind eben doch überall gleich.“
Am 21. Dezember 2018 stellt die ZEIT auf ihrem „Glashaus“-Blog fest, dass Lynch diese Aussagen so niemals getroffen hat. Die Wochenzeitung bezieht sich dabei auf ein Dokument, das sie von Lynchs Produktionsfirma übermittelt bekam. Der Regisseur sagt dort eher trocken und wenig prägnant auf dieselbe Frage:
„Bis jetzt haben wir keine signifikanten Unterschiede zwischen den geografischen Regionen festgestellt. Diese Frage wird besser zu beantworten sein, wenn wir den Schnittprozess abgeschlossen haben.“
Die oben zitierte Passage ist jedoch nur ein Beispiel für den ganzen Text. So attestiert der „Glashaus“-Blog, „dass die bei uns erschienenen Interviewaussagen zu etwa zwei Dritteln erfunden sind und zu einem Drittel zumindest sehr frei übersetzt“. Vor diesem Hintergrund ist auch vom FTD-Bericht über das Lynch-Projekt nichts Besseres zu erwarten.
Fact-Checking: Melina Kersten, Pascal Patrick Pfaff, Melina Seiler
In dem Artikel „Zu Gast bei Hofe” (03.06.2011) berichtet Claas Relotius von dem Fotoprojekt „Little Adults” der deutschen Fotografin Anna Skladmann, die in Moskau Milliardärskinder porträtiert hat. Der Großteil der Informationen des Artikels lässt sich auf Aussagen der Fotografin zurückführen. In Bezug auf ihre Arbeit wird sie mehrfach direkt und indirekt zitiert. Für den Leser entsteht der Eindruck, dass Relotius Skladmann im Rahmen seiner Recherche kontaktiert hat. Die Ortsmarke „Moskau“ nach dem Autorennamen suggeriert, Relotius sei vor Ort gewesen und habe die Fotografin dort getroffen.
Somit bildet Anna Skladmann den Mittelpunkt der Überprüfungsrecherche und wurde in einem ersten Schritt telefonisch kontaktiert. Bei unserem Telefonat am 04.04.2019 stellte sich heraus, dass die Fotografin weder Claas Relotius noch seinen Artikel kennt. Sie zeigte sich sehr verwundert über ihre aktive Rolle in dem Text, bestätigte jedoch die Existenz des Fotoprojektes „Little Adults”. Auch die von Relotius verwendeten Zitate bestätigte sie mit dem Hinweis, dass sie diese in Interviews mit anderen Journalisten gesagt habe. Welche Interviews das sind, ließ sich indes nicht herausfinden.
Zudem bestätigt Skladmann alle genannten Fakten zum Fotoprojekt, wie zum Beispiel ihre Inspirationsquelle Walentin Serow sowie die Namen und Hintergründe der porträtierten Kinder. Das zeigt auch der Blick in den Fotoband: Die Relotius-Passage „ihre Eltern gehören zu den Nouveaux Riches. Einer Schicht, die nach dem Zerfall der Sowjetunion zu großem Reichtum gekommen ist” lässt sich sinngemäß im Intro des Buches wiederfinden. Skladmanns berufliche Laufbahn ist ebenfalls im Fotoband angegeben. Auch die Bilder beschreibt Relotius zutreffend und seine Interpretationen der Motive sind nachvollziehbar.
Unstimmigkeiten gibt es bei der szenischen Einleitung: Relotius beschreibt ein Bild auf dem eines der porträtierten Kinder mit einer Waffe posiert und sagt, dass es sich dabei um eine „MP 40 der deutschen Wehrmacht, ein Original aus dem Beutefundus der Roten Armee“ handeln soll. Zudem sei es das „Lieblingsstück” des Jungen. Skladmann erinnert sich jedoch, dass sich der Junge beim Foto Shooting willkürlich für eine Waffe aus dem Waffensortiment entschieden habe – an das Modell könne sie sich nicht erinnern. Außerdem habe sie einen Deal mit den Eltern der Kinder, wonach keine privaten Informationen an die Öffentlichkeit gelangen dürfen. Von der Fotografin kann die Information demnach nicht stammen. Woher also will Relotius wissen, dass es das „Lieblingsstück“ des Jungen ist? Es ist eher unwahrscheinlich, dass Relotius diese Informationen direkt von der Familie des Jungen erhalten hat.
Weiterhin schreibt Relotius, dass „in Russland mehr als 25 Millionen Menschen unterhalb der Armutsgrenze leben”. Laut der Quelle Russland-Analysen (PDF) aus dem Jahr 2011, in dem der Artikel veröffentlicht wurde, waren es jedoch etwa sechs Millionen weniger. Ähnlich steht es im CIA World Factbook.
Fact-Checking: Wiebke Knoche, Julian Schröder, Sara Tavakoli
In seinem Bericht aus Dänemark „Schussfahrt am Schornstein” (16.06.2011) schildert Claas Relotius den geplanten Bau eines Heizkraftwerks in Kopenhagen, welches neben modernem Design auch eine eigene Skipiste auf dem Dach haben soll. Im Artikel wird der Architekt des Projektes, Bjarke Ingels, häufig zitiert.
Die Vermutung, Relotius könnte hier plagiiert haben, kam dadurch auf, dass neben internationalen Medien auch ZEIT Online bereits vor ihm einen Artikel zu diesem Thema veröffentlicht hatte, der teilweise sehr ähnliche Informationen und Zitate beinhaltet.
So behauptet Relotius, dass es vier Monate lang in Kopenhagen Nachtfrost gebe. Dies sagt Ingels im ZEIT Online-Interview ebenfalls, Relotius führt die zudem falsche Behauptung (tatsächlich sind es nur knapp zwei Monate) in seinem Artikel jedoch als Fakt an und kennzeichnet sie nicht als Zitat. Ebenso spricht er in seinem Artikel von „wintersportaffinen Dänen”. Ähnlich dazu hatte Ingels ZEIT Online gesagt, dass Kopenhagener häufig bis zu acht Stunden ins nächste Skigebiet führen. Auch bezieht sich Relotius auf die „hedonistische Nachhaltigkeit der Anlage”, von welcher Ingels in einem Vortrag spricht, der wiederum ebenfalls auf ZEIT Online erwähnt wurde. Relotius nennt für die Zitate keine Quellen.
Andere Relotius-Behauptungen stimmen wiederum nicht mit dem ZEIT Online-Artikel überein. So beschreibt Relotius, dass das Gebäude 103 Meter hoch werde, während ZEIT Online 100 Meter als Wert angibt und ergänzt, dass es damit eines der größten Gebäude von Kopenhagen sein werde. Relotius hingegen schreibt, dass die Anlage der zweithöchste Berg Dänemarks werde, was ebenfalls nachweislich falsch ist: Der neunthöchste Berg Dänemarks, Troldemose Bakke, ist beispielsweise bereits 110 Meter hoch. Der höchste Berg ist der Yding Skovhøj mit 172 Metern.
Viele der im Relotius-Artikel genannten Auskünfte und Zahlenwerte zu der Müllverbrennungsanlage sind, wie uns die Pressestelle der Anlage auf Nachfrage per Mail bestätigte, falsch oder ungenau formuliert. So behauptet Relotius in seinem Artikel, die Anlage „versorgt täglich 140.000 Haushalte mit Strom und Wärme” – tatsächlich versorgt sie derzeit laut Betreiber lediglich 60.000 Haushalte.
Auch ist von Protesten gegen die Müllverbrennungsanlage die Rede. Diese bezogen sich laut der Pressestelle allerdings auf die verwendeten Technologien, nicht aber auf die Anlage selbst. Relotius schreibt auch von einem Panorama-Restaurant, tatsächlich ist aber nur ein Café vorhanden – am Fuße der Anlage. Dass es sich um eine vorsätzliche Täuschung seitens Relotius handelt, ist jedoch nicht anzunehmen, da das Gebäude zum Zeitpunkt seines Artikels (2011) noch in Planung war und sich das Bauvorhaben mit der Zeit geändert haben kann.
Zusammenfassend lässt sich vermuten, dass sich Relotius für diesen Artikel aus mehreren anderen journalistischen Quellen bedient hat. Auch konnten einige faktische Fehler aufgezeigt werden, die durch eine gründliche Recherche hätten vermieden werden können. Ob ein Interview zwischen Relotius und Bjarke Ingels stattgefunden hat, ließ sich leider nicht verifizieren, da das Büro des Architekten auf unsere Anfrage nicht reagierte.
Fact-Checking: Christina Rech, Christian Schierwagen, Lennard Schmeller
In dem Artikel „Going Underground“ (28.07.2011) berichtet Claas Relotius über leerstehende ehemalige U-Bahn-Stationen der Londoner „Underground“, die der Geschäftsmann Ajit Chambers in „moderne Amüsiermeilen“ mit Restaurants, Eventlocations und Museen umwandeln möchte. Der Text enthält zwar sachliche Ungenauigkeiten, jedoch keine konkreten Belege für Fälschungen oder Plagiate.
Auf Anfrage bestätigte Chambers uns sowohl sein Treffen mit Relotius in der beschriebenen U-Bahn-Station als auch die verwendeten Zitate und Aussagen des Geschäftsmannes: „Yes, I remember him. All these details in the article are exactly true.” Die Beschreibungen der U-Bahn-Station und die Szenerie lassen sich anhand von YouTube-Videos, unter anderem von Chambers selbst, sowie durch Artikel in britischen Medien bestätigen.
Im Hinblick auf geschichtliche Gegebenheiten fällt eine sachliche Ungenauigkeit auf. So stellt Relotius die Unterbringung von Rudolf Heß während des zweiten Weltkrieges als Tatsache dar, obwohl sich dies nicht verifizieren ließ. Zahlreiche Medien, darunter auch britische und österreichische, berichten in diesem Zusammenhang stets von Vermutungen oder Gerüchten, stellen aber keine Tatsachenbehauptung auf.
Ähnlich verhält es sich mit der von Relotius genannten Zahl der leerstehenden U-Bahn-Stationen, die er mit 26 beziffert. Die genaue Anzahl ist der Londoner Verkehrsgesellschaft (PDF) zufolge nur schwer anzugeben, liegt vermutlich aber höher. In einem Artikel auf Spiegel Online, der etwa drei Monate vor Relotius’ Text erschien, und in weiteren Medienberichten sowie auf der Webseite von Chambers‘ Unternehmen heißt es indes, dass der Geschäftsmann 26 Stationen für sein Vorhaben ins Auge gefasst habe. Auch wenn sich kein konkreter Plagiatsverdacht begründen lässt, legen inhaltliche Ähnlichkeiten der beiden Artikel nahe, dass Relotius sich möglicherweise von der Spiegel-Berichterstattung inspirieren ließ. So benutzt er zur Illustration dieselben Beispiele, z.B. Dreharbeiten zu Harry Potter-Filmen und historische Bezüge zu Winston Churchill.
Fact-Checking: Leon Tom Gerntke, Jana Krest, Leonie Wunderlich
In dem Artikel „Einmal der Nazi sein“ (05.08.2011) berichtet Claas Relotius über die „War and Peace Show“ – einem Festival, auf dem Militaria-Fans Schlachten aus vergangenen Kriegen mit originalem Equipment oder detailgetreuen Nachbildungen von Waffen und Ausrüstung nachspielen.
Die Show findet, wie von Relotius beschrieben, jährlich in der südenglischen Grafschaft Kent an einem verlängerten Juli-Wochenende statt. Ebenso bestätigte unsere Recherche, dass an dem Festival Kriegsbegeisterte aus verschiedensten Ländern, u.a. auch aus Deutschland, teilnehmen. Die Beteiligung deutscher Neonazis, die Relotius in seinem Artikel beschreibt, wird somit durchaus plausibel. Auch zeigt Videomaterial, dass die nachgespielten Schlachten tatsächlich durch den Pfiff einer Trillerpfeife beendet werden.
Ungenau wird der Autor allerdings bei zwei grundlegenden Informationen. Laut Relotius liegt der Austragungsort „eine knappe Autostunde von London entfernt“. Das Überprüfen mittels Google Maps und dem Online-Routenplaner wego.here.com (1 Stunde 18 Minuten) ergab allerdings eine Fahrzeit von etwas mehr als einer Stunde.
Auch die Zuschauerzahl, die von mehreren Quellen mit bis zu 100.000 Zuschauern angegeben wird, schmückt Relotius mit „über 100.000 Besucher“ etwas aus. Zudem erweckt er den Eindruck, bei der „War and Peace Show“ erfolge lediglich ein Nachstellen von Szenen aus dem Zweiten Weltkrieg. Videomaterial zeigt allerdings deutlich, dass ebenso Schlachten aus anderen Kriegen, wie z.B. dem Vietnam- oder Afghanistankrieg, nachgespielt werden. Unklar bleibt auch, ob der Organisator Rex Cadman, der nachgewiesenermaßen die Show bis 2015 veranstaltete, seine im Text zitierte Aussage so getätigt hat.
An der „War and Peace Show“ nimmt regelmäßig die Reenactment-Gruppe „Second Battle Group“ teil. Übereinstimmend mit Relotius‘ Angaben mimt diese die SS-Leibstandarte Adolf Hitler. Ihre Mitglieder wirkten auch als Statisten im Film „Der Soldat James Ryan“ mit. Wie uns die Second Battle Group jedoch via Facebook erklärte, hat es den von Relotius vorgestellten, angeblich begeisterten Nazi-Darsteller Adam Riley („hat seine ganze Familie mitgebracht, um bis ins letzte Details die Rolle des bürgerlichen Wehrmachtsoffiziers zu spielen“) nie in der Darstellertruppe gegeben. Es ist somit anzunehmen, dass diese Person frei erfunden ist.

Hat es Relotius‘ Protagonisten Adam Riley nie gegeben? Seine vermeintlichen Mitstreiter „certainly do not ever remember anyone of that name“.
Auch die Existenz des Protagonisten Tony Prescott ließ sich nicht nachweisen. Laut Relotius ist Prescott ein Busfahrer und Bowlingspieler aus dem Londoner Vorort Redhill. In einer Mitgliederliste der Bowlingvereine aus Redhill ließ sich sein Name jedoch nicht finden. Gegen Ende seines Artikels stellt Relotius Barry Adams vor – ein Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg, der als Funker im Sturm auf Omaha Beach zum Einsatz gekommen sein soll. Wie Relotius schreibt, können sich Veteranen die Show als Ehrengäste kostenlos ansehen – dies bestätigten uns auch die Organisatoren:
Unsere Suche im Nationalarchiv sowie im Veteranenverzeichnis führte zwar zu mehreren Veteranen namens Barry Adams, jedoch gelang uns kein Treffer zu einem gleichnamigen Veteranen, der 1944 am Omaha Beach als Funker im Einsatz war. Somit erscheint die Existenz der Personen Tony Prescott und Barry Adams zumindest fragwürdig.
Insgesamt erweckt der Artikel von Claas Relotius den Eindruck, als habe er die grundlegenden Fakten zur „War and Peace Show“ recherchiert. Ungenauigkeiten in Detailfragen (z.B. Anfahrtszeit, Zuschauerzahl, welche Kriege werden nachgestellt) stellen die tatsächliche Anwesenheit des Autors auf dem Festival jedoch in Frage. Zudem existiert einer seiner Protagonisten, zumindest in seiner ihm zugeschriebenen Rolle, nachweisbar nicht. Die handelnden Personen scheinen eher der von Relotius erwünschten Dramaturgie zu dienen, als dass sein Artikel auf vor Ort gewonnenen, tatsächlichen Eindrücken und interviewten Personen beruht.
Fact-Checking: Paulina Marciniec, Sophie Prüfert, Ansgar Wagenknecht
In dem Artikel „Gangster’s Paradise“, veröffentlicht am 27.04.2012, berichtet Claas Relotius über die norwegische Gefängnisinsel Bastøy, auf der die Insassen wie im Urlaub leben. Anstatt ihre Haft in Zellen abzusitzen, gehen Schwerverbrecher hier täglich angeln und reiten.
In Relotius‘ Geschichte gibt es zwei Protagonisten: Arne Nilsen, ehemaliger Gefängnisdirektor, und Cato Norkheim, ein Drogenschmuggler und Insasse. Dass beide Personen existieren, bestätigte uns der aktuelle Leiter von Bastøy, Tom Eberhardt, auf Anfrage. Allerdings fehlen Aufzeichnungen aus der damaligen Zeit, sodass Eberhardt weder bestätigen noch falsifizieren kann, ob Relotius jemals vor Ort gewesen ist und mit Personal und Insassen gesprochen hat.
Die Angaben, die Relotius über die Anzahl und Freizeitbeschäftigungen der Insassen macht, stimmen mit denen der offiziellen Webseite der norwegischen Haftanstalt überein – er könnte sie auch von dort gehabt haben. Auch die Beschreibung der Häuser und der Insel scheinen sich zu decken. Die einzigen Zellen, die es laut Relotius auf der Insel gibt, beschreibt er als „einen Quadratmeter groß, rot lackiert, und man kann in ihnen kostenlos telefonieren“. Falls Relotius diese nicht mit eigenen Augen gesehen hat (weil er mutmaßlich nie auf der Insel war), dann hat er diese Details womöglich von einem Foto auf der Website der Daily Mail vom 25. Juli 2011. Dieser reich illustrierte Bericht bietet so einiges für Reporter, die aus der Ferne plastisch beschreiben wollen.
Bekanntlich hat Relotius auch in der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag (NZZ aS) einen Artikel über Bastøy unterbringen können. Dieser erschien am 8. April 2012, also noch einige Wochen vor der Version in der FTD, die insgesamt kürzer ist. Die Schweizer Redaktion kam nach ihrer Überprüfungsrecherche zu dem Schluss, dass Relotius wahrscheinlich nicht auf Bastøy gewesen ist (niemand könne sich an ihn erinnern, so Eberhardt gegenüber der NZZ aS) und es habe auch niemals einen Gefangenen namens Per Kastaad gegeben.
Mit einem Protagonisten dieses Namens hatte Relotius seine große Reportage in der Schweizer Wochenzeitung enden lassen: „Er ist 47 Jahre alt, hat graue Locken, breite Schultern, einen verschlagenen Blick“. Kastaad sei ein Häftling, der mit dem relativ freien Leben auf Bastøy erst das große Los gezogen hatte, dann aber merkte, dass er mit der Freiheit nicht umgehen könne. Und sofort zurückwollte in einen normalen, strengen Knast.
Wir haben eine Vermutung, woher Relotius diese Idee hatte: von Nicola Abé, einer Spiegel-Reporterin, die schon Anfang 2011, also ein Jahr vor Relotius, über Bastøy berichtete und von der norwegischen Gefängnisinsel den Fall von Raymond Olsen mitgebracht hatte – auch er ein Straftäter, der die Freiheit nicht aushält und zurück will in eine Haftanstalt mit totaler Überwachung. Mit der Szene der kurz bevorstehenden Rücküberführung endet Abés Reportage – ebenso wie Relotius‘ Variante in der NZZ aS.
Die Textähnlichkeiten sind frappierend – auch für Nicola Abé, die Relotius‘ Text noch nicht kannte und ebenfalls den Eindruck hat, dass bei ihr abgeschrieben wurde. Abés Reportage kann man hier nachlesen, sie erschien auch auf Englisch.
Ein letztes Detail: Die Prozentzahlen, die Relotius über die Rückfallquote von freigelassenen Sträflingen nennt, lassen sich klar falsifizieren. So behauptet er, die Quote in Norwegen liege bei 37,5 Prozent („nur halb so hoch“, bezogen auf 75 Prozent als angeblichem gesamteuropäischem Durchschnitt). Wie aus einer Studie der Universität Lausanne im Auftrag des Europarats von 2010 hervorgeht, lag die Rückfallquote in Norwegen damals sogar bei nur bei 20 Prozent.
Fact-Checking: Louise Bot, Samira Debbeler, Carlotta Kurth
Message hat mit sechs ehemaligen FTD-Redakteuren in damals verantwortlicher Position gesprochen. In ihren Reaktionen überwog die Überraschung, auch das Erschrecken, und es gab Verwunderung, dass bislang noch niemand den Fall aufgegriffen hatte. Viele erinnern sich gar nicht an den Autorennamen „Relotius“. E-Mail-Verkehr aus der damaligen Zeit gibt es wohl nicht mehr (Papier überdauert da eher, heute regiert die digitale Vergesslichkeit). Ob von Relotius angelieferte Informationen je hinterfragt wurden, kann auch niemand sagen. Rainer Leurs, der als Koordinator des „Weekends“ mehrmals mit Relotius zu tun hatte, erinnert sich an einen „ganz tüchtigen, kreativen, aber sonst nicht weiter auffälligen Jungreporter“. Als der seine ersten Preise einheimste, habe er, Leurs, sich noch gewundert, ob er da wirklich ein großes Talent übersehen hatte. Heute ist Leurs, der in seiner Hamburger Zeit nie persönlichen Kontakt mit Relotius hatte, Online-Chef der Rheinischen Post.*
Die zehn Texte aus der FTD zeigen ein Muster, ein Verfahren, das schon der frühe Relotius karriereförderlich praktizierte: Attraktive Plot-Elemente seiner Stories (wie den Häftling, der von der Insel zurück will in den strengen Knast) fand er bei anderen. Er komplettierte diese Vorlagen zum einen mit Fakten, die er nicht immer akkurat recherchierte und verarbeitete, und zum anderen mit Zudichtungen, die die Geschichten offenbar nochmals aufhübschen sollten.
„Puh, schwer, du meinst, wie ich auf Themen komme? Einfach, denke ich, durch Querlesen anderer, eigentlich sämtlicher anderen Zeitungen, auch in internationalen.“
Die vielen ähnlichen, jeweils vor den FTD-Artikeln erschienenen Internet-Quellen, die die Master-Studierenden der Journalistik und Kommunikationswissenschaft an der UHH bei dieser Übung im Kurs „Recherche II“ des laufenden Sommersemesters aufgefunden haben, zeigen auch die gefährliche Verführungskraft des Internets: In diesem Schaufenster zur Welt ist so vieles zu schnell gefunden. Interessant scheinende Realitätspartikel lassen sich mittels copy and paste allzu leicht in den eigenen, gerade erst entstehenden Artikel übernehmen. Bei dieser Übertragung unterlaufen dann Bearbeitungsfehler (wie eine plötzlich fehlerhafte Altersangabe), die später auffallen können – aber eben in Redaktionen wie der FTD (die keine Dokumentationsabteilung hatte) zu selten auffallen. Mindestens aber hätte ein skeptischer Redakteur das eine oder anderen via Google gegenprüfen können.
Claas Relotius jedenfalls scheint ein ganz eifriger Googler gewesen zu sein. Einer, der die Berichte anderer synthetisierte. In einem Interview, dass Eleni Klotsikas am 6.12.2013 für das RBB-Medienmagazin mit Relotius führte, antwortete er auf die Frage, wie er bei der Themenwahl vorgehe, so: „Puh, schwer, du meinst, wie ich auf Themen komme? Einfach, denke ich, durch Querlesen anderer, eigentlich sämtlicher anderen Zeitungen, auch in internationalen. Und oft entdeckt man da ja Aspekte von Geschichten, aus denen sich wieder neue Geschichten ergeben. Und das ist, glaube ich, so immer noch wie man auf Geschichten kommt, also eigentlich ganz profan, aber ich wüsste gar nicht, wie es anders laufen soll.“
Für einen Reporter, der vom eigenen Augenschein lebt, der Neues, noch nicht Berichtetes in die mediale Öffentlichkeit bringen sollte, ist das ein Armutszeugnis – und eine Selbstentlarvung, die man damals noch nicht verstehen konnte.
Würde man seinen oben überprüften Reiseerzählungen glauben, wäre Relotius vor allem im Jahr 2011, als die meisten, nämlich sieben der zehn FTD-Beiträge erschienen, ein Vielreisender gewesen. Und das, obwohl er sich doch anschickte, an der Hamburg Media School seine Abschlussprüfung im (inzwischen eingestellten) Studiengang „Master of Arts in Journalism“ abzulegen. 2011 war also demnach ein überaus arbeitsreiches Jahr für ihn.
Die damals geltende Prüfungsordnung sah vor: „Die Anfertigung der Master-Thesis dient dem Erwerb und Nachweis der Qualifikation, eine anwendungsbezogene Problemstellung aus einem Fachgebiet des Studiums selbständig (sic!) und nach wissenschaftlichen Grundsätzen und Methoden im Rahmen einer größeren schriftlichen Arbeit zu bearbeiten.“
Ob es dazu kam und welche akademische Qualität das Ergebnis hatte, lässt sich bislang nicht überprüfen, weil die HMS Externen jegliche Einsicht in die Abschlussarbeit strikt verweigert. Auch Fragen zu Relotius werden nicht beantwortet. „Zu seiner konkreten Arbeit kann ich Ihnen insbesondere aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskunft geben“, beschied HMS-Geschäftsführerin Katharina Schaefer den Autor knapp.
Natürlich sind gerade bei Prüfungsarbeiten die Persönlichkeitsrechte von Prüflingen zu achten. Grundsätzlich herrscht Vertraulichkeit, es sei denn, ein Absolvent, eine Absolventin stimmt der Einstellung seiner/ihrer Arbeit in eine Bibliothek zu. Die Frage ist aber, ob hier nicht wegen des hohen öffentlichen Interesses ein besonderer Fall gegeben ist. Und ob sich die HMS nicht besser an der Transparenzoffensive aller Organisationen, die von Relotius betroffen waren, beteiligen sollte.
Folgt man einem Tweet der HMS vom 26. Juli 2012, bestand die Prüfungsleistung vor allem aus einem Filmbericht: „Reportage im NDR: Dieser Film ist 2011 als Masterarbeit von Mareike Müller und Claas Relotius entstanden.“ Der in dem HMS-Tweet angegebene Link zum Film führt heute ins Leere – laut NDR war der Film zwölf Monate nach Ausstrahlung regulär offline gegangen, dem damals geltenden Telemedienkonzept entsprechend.
Doch der Film ist nicht verloren. Als Videodatei liegt er dem Autor vor. Warum? Der schon damals auf Anerkennung erpichte Relotius hatte sich damit 2012 um den Brenner-Preis in der Sparte „Newcomer“ beworben. Der Autor ist Brenner-Juror und fand den Film in seinem digitalen Archiv. Relotius‘ Mitbewerberin war seine Ko-Autorin Mareike Müller, heute Journalistin in Berlin. Kurz zuvor hatten die beiden schon einen Nachwuchspreis erhalten: den RTL Com.mit Award für Integration. Die RTL-Website zeigt noch heute einen forsch in die Kamera blickenden Preisträger Relotius neben RTL-Chefredakteur Peter Kloeppel und der damaligen Staatsministerin der Bundesregierung für Integration, Maria Böhmer.
Inhaltlich handelt es sich um einen gut 6-minütigen Filmbericht „Luftschloss Europa – Keine Perspektive für afrikanische Flüchtlinge“, der im Sommer 2011 entstand und den das NDR Fernsehen am 24. Juli 2012 in der Reihe „Weltbilder“ ausgestrahlt hatte. Der Filmbericht zeigt afrikanische Arbeitsmigranten, die auf ein besseres Leben in Europa gehofft hatten, dann in der spanischen Provinz Huelva gestrandet waren und nun in einem Wald vor sich hinvegetieren – geduldet von der Polizei und notdürftig versorgt von einem Gewerkschafter und dem spanischen Roten Kreuz. Der Filmtext ist hier abrufbar (PDF).
Betrachtet man den Film unvoreingenommen, löst er keinerlei Fälschungsverdacht aus. Alles scheint authentisch, nicht zuletzt, weil Offizielle des Roten Kreuzes im Bild erscheinen. Auch bezeugt Mareike Müller auf Message-Anfrage, dass die beiden Jungreporter im Sommer 2011 elf Tage vor Ort in Spanien waren – und zwar genau vom 15. bis zum 25. August 2011. Die Reisekosten übrigens wurden gegen Nachweis von der HMS bezuschusst, mit 800 Euro pro Person, erinnert sich Müller.
So weit, so unbedenklich. Und doch ist der Fall voller Merkwürdigkeiten. Es stellen sich zwei Kernfragen – eine an die HMS und die andere an den NDR.
Erstens: War die kleine Auslandsreportage über die in Spanien gestrandeten Afrikaner überhaupt durch die 2011 geltende Prüfungsordnung gedeckt? Schließlich war in dieser rechtsverbindlichen Vorschrift, siehe oben, von einer „größeren schriftlichen“, nicht von einer kleineren audiovisuellen Arbeit die Rede.
Zweitens: Wie ist es zu erklären, dass das NDR Fernsehen den Film noch ein Jahr nach Entstehen in der Auslandsreihe „Weltbilder“ zeigte? Die Verhältnisse vor Ort in Spanien konnten sich geändert haben. Wollte man dem Publikum im Ernst weismachen, der Film schildere aktuelle Gegebenheiten? Gilt die Qualitätsnorm „Aktualität“ nicht gerade im Fernsehen?
Der NDR sieht gar kein größeres Problem darin, dass der Bericht erst ein Jahr nach Entstehen gesendet wurde. „Die Problematik der afrikanischen Arbeitsmigranten in Spanien war zu diesem Zeitpunkt noch nicht in den ,Weltbildern‘ thematisiert worden, das wird vermutlich die Grundlage für die Entscheidung zum Ankauf gewesen sein.“ Genaueres lasse sich nicht mehr sagen, da der begleitende E-Mail-Verkehr nicht archiviert wurde.
Grundsätzlich gelte: „Wenn zwischen der Veröffentlichung und dem Dreh eines Filmes ein längerer Zeitraum liegen sollte, was nur äußerst selten vorkommt, dann wird mit journalistischer Sorgfalt geprüft, ob sich dies inhaltlich vertreten lässt. Dazu werden die Protagonisten erneut vom Autor/der Autorin bzw. dem Producer/der Producerin kontaktiert. Außerdem wird aufgrund einer Analyse der möglichen politischen/gesellschaftlichen Entwicklungen eingeschätzt, ob die Situation im Allgemeinen gleich geblieben ist oder sich geändert hat.“
Wenn alles mit rechten Dingen zugegangen sein sollte, dann hätte also die NDR-Redaktion Claas Relotius als Autor und Producer in einer Person aufgefordert, die Lage vor Ort in Spanien noch mal zu prüfen. Aber ist die Annahme realistisch, dass das geschehen ist? Eine zweite Auslandsreise wird er deshalb wohl kaum angetreten haben.
Ein Jahr ist lang. Obwohl das Migrationsproblem natürlich chronisch ist, auch in Spanien, könnte der Wald bei Huelva 2012 bereits geräumt gewesen sein – dem Publikum wäre also verspätet über ein Phänomen berichtet worden, das sich mit seinen Protagonisten längst verflüchtigt hatte.
Ob die Zuschauerinnen und Zuschauern des NDR Fernsehens wenigstens darüber aufgeklärt wurden, dass sich alles so vor einem Jahr zugetragen hatte? Der Sender räumt ein, dass dies nicht geschah, zeigt sich ansonsten aber wenig problembewusst: Die Redaktion halte es „inhaltlich weiterhin nicht für notwendig“, diese Einschränkung der Gültigkeit offenzulegen. Wie ein billig zu habendes Zugeständnis an kritische Nachfrager wirkt es da, wenn der NDR-Sprecher hinterherschiebt: „Im Sinne eines transparenten Umganges wäre aber z. B. ein Hinweis in der Moderation auf die Masterarbeit und den damit verbundenen Dreh-Zeitraum problemlos möglich und für den Zuschauer sicherlich interessant gewesen.“
Wir wüssten sogar eine Eselsbrücke, über die der NDR hätte gehen können. Das wäre der schon erwähnte, am 20. Juni 2012 in Berlin an Relotius und Müller verliehene RTL Award gewesen. Eine aktuelle Auszeichnung für Hamburger Nachwuchsjournalisten als Sendeanlass, das hätte man in einer Moderation gut verpacken können. Aber das hätte ja bedeutet, Publicity für einen kommerziellen Fernseh-Konkurrenten zu machen. Geht irgendwie auch nicht.
* Hinweis: Eine Stellungnahme von Steffen Klusmann als ehemaligem FTD-Chefredakteur ist angefragt, traf aber bis Redaktionsschluss nicht ein und wird ggf. nachgetragen.

Kann Journalismus die Demokratie schützen? Diese Frage hatte das Institut für Digitale Ethik Message-Herausgeber Volker Lilienthal gestellt. In seinem Vortrag am der Hochschule der Medien in Stuttgart Anfang Dezember 2018 gab der Professor für „Praxis des Qualitätsjournalismus“ an der Universität Hamburg eine zwiegespaltene Antwort: einerseits ja, andererseits Nein.
Nein, weil …
Ja, weil …
Das globale politische Phänomen, das sich in Deutschland vor allem in den Wahlerfolgen der Alternative für Deutschland (AfD) widerspiegelt, zeige eine große Unzufriedenheit unter Bevölkerungsgruppen, „die ihren politischen Willen nicht ausreichend repräsentiert sehen“, sagte er.
Der Journalismus, den es laut Lilienthal braucht, um die Welt zu verstehen und um sich zu orientieren, sieht sich mit einer gesellschaftlichen Strömung konfrontiert, deren Verhältnis zu Medien besonders angespannt ist. Dabei wies der Inhaber der Rudolf-Augstein-Stiftungsprofessur an der Universität Hamburg auf einen Widerspruch hin: Der Vorwurf der Populisten, es gebe keine Meinungsfreiheit (stattdessen nur medialen Mainstream oder „betreutes Denken“), wird Lilienthal zufolge dadurch widerlegt, dass heutzutage jeder über die Sozialen Medien seine Meinung mitteilen kann.
In seinem Stuttgarter Vortrag hob Lilienthal hervor, dass die populistische Medienkritik nicht bei folgenlosen Worten stehenbliebe. So seien unliebsame Journalisten von AfD-Parteitagen ausgeschlossen worden, würden nicht mehr eingeladen oder ihre Anfragen nicht beantwortet. Schlimmer noch seien die zunehmenden tätlichen Angriffe auf Berichterstatter bei Demonstrationen von populistischen Gruppen, etwa in Chemnitz.
Wie soll der Journalismus auf solche Provokationen und Angriffe reagieren? Lilienthal sagte, die AfD habe kein Recht, von der kritischen Berichterstattung ausgeschlossen zu werden. „Es kann keine Neutralität im Journalismus geben, wenn rote Linien überschritten wurden.“ Das sei etwa der Fall, wenn Alexander Gaulands äußert, Hitler und die Nazis seien nur „ein Vogelschiss“ in über 1.000 Jahren deutscher Geschichte. Wie darauf antworten? Als Musterbeispiel verwies Lilienthal auf den Tagesspiegel, der als Reaktion auf die Äußerung eine ganze Titelseite mit einer Bildercollage von Nazi-Verbrechen und deren Folgen füllte. Ein visueller Kommentar, wo Worte nicht mehr zu helfen scheinen.

von Volker Lilienthal
Der öffentliche Raum – wird er nicht längst von den Rechtspopulisten und ihren medialen Nachsprechern dominiert? Viele Liberale haben den Eindruck, der „Vogelschiss“ sei salonfähig geworden und die Losungen der AfD seien ansteckend eingesickert in den Disput, wie er zum Beispiel in den TV-Talkshows gepflegt wird.
„Heimat Deutschland – nur für Deutsche oder offen für alle?“ fragte Frank Plasberg am 25. Februar. Schon alleine der Titel hatte bereits vor der Sendung für Proteste gesorgt, zum Beispiel bei Hasnain Kazim, Spiegel-Korrespondent in Wien, der auf Twitter mit der Redaktion diskutierte: „Hallo @hartaberfair, ihr meint also, die Antwort: ,Nein, nicht offen/keine Heimat zum Beispiel für Leute wie dich!‘ ist eine ,Möglichkeit‘? Ernsthaft? Ob ihr’s glaubt oder nicht, aber es gibt eine Menge Leute, die so denken. Und diesen Leuten gebt ihr Raum? Wirklich?“
Hallo @hartaberfair, ihr meint also, die Antwort: „Nein, nicht offen/keine Heimat zum Beispiel für Leute wie dich!“ ist eine „Möglichkeit“? Ernsthaft? Ob ihr’s glaubt oder nicht, aber es gibt eine Menge Leute, die so denken. Und diesen Leuten gebt ihr Raum? Wirklich? https://t.co/ITCARQrhE4
— Hasnain Kazim (@HasnainKazim) 25. Februar 2019
Streitfälle wie dieser zeigen, dass die Stimmung in Deutschland angesichts der rechtspopulistischen Herausforderung nicht mehr gelassen ist, sondern einigermaßen nervös. Viele haben den Eindruck, es tobe ein Kampf um kulturelle Hegemonie – den die Demokraten, Liberalen und Weltoffenen verlieren könnten.
Auch gegen solchen Pessimismus richtete sich die Konferenz der Rudolf Augstein Stiftung am 22. Februar 2019: „re:claim public discourse“. Im Spiegel-Haus an der Ericusspitze in Hamburg ging es um nicht weniger als um die Rückeroberung des öffentlichen Raums – mindestens aber um die Formulierung von Gegenstrategien. Wobei der Schwerpunkt auf journalistischen Strategien lag, weniger auf politischen.
Mit „Reclaim Autonomy – Selbstermächtigung in der digitalen Weltordnung“ hatte die Augstein-Stiftung die re:claim-Marke 2016 erstmals gesetzt. Das damalige Symposium war dem Andenken an den 2014 verstorbenen Publizisten und FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher gewidmet. Die Ergebnisse der Erörterungen können in einem 2017 erschienenen Band der edition suhrkamp nachgelesen werden.
Stiftungsvorstand Jakob Augstein setzte gleich zu Anfang einen Ton, der die Gefahr signalisierte, obwohl er zu beschwichtigen schien: Noch führen keine Panzer vor, „noch rollen keine Köpfe“. Zu beobachten sei eine schleichende Veränderung der politischen Verhältnisse. Offenbar sind Panzer aber wieder vorstellbar geworden – und zwar deshalb, weil die enttabuisierende Ausweitung des wieder Sagbaren weit vorangeschritten ist.

Mehr als 160 Teilnehmende kamen zur Konferenz „Reclaim Public Discourse“ der Rudolf-Augstein-Stiftung, am 21. und 22. Februar 2019 im Spiegel-Gebäude in Hamburg. Foto: Rudolf Augstein Stiftung
Hamburgs Kultur- und Mediensenator Carsten Brosda zeigte sich von Augsteins Steilvorlage sichtbar angesprochen und wich vom Redemanuskript ab. Der Zusammenhalt der demokratischen Gesellschaft sei strittig geworden, keine Selbstverständlichkeit mehr. Brosda sieht eine „überproportionale Betonung des Individuellen“ am Werk und das Problem, dass aus der digital ermöglichten Vielzahl der Meinungsäußerungen noch lange kein Meinungsbildungsprozess folge. Wie kann man es schaffen, so fragte Brosda, die Meinung der Bürger „nicht nur algorithmisch zu aggregieren, sondern diskursiv zu vernetzen“? Mindestvoraussetzung dafür: Wir alle müssen überzeugbar bleiben. Sonst sei der Diskurs tot.
Radikal zu Ende gedacht, müsste das aber auch für die Liberalen gelten, von denen eben auch nicht wenige glauben, die Wahrheit gepachtet zu haben. Die Darmstädter Soziologin Cornelia Koppetsch wies darauf hin, dass der Liberalismus heute die eigentlich konservative Position sei, weil er für den Systemerhalt plädiere. Dieses Milieu sei hochgradig irritiert von einem „Aufbegehren der Laien“, die so vieles, was bisher in der befriedeten Bundesrepublik galt – vom Großen des Asylrechts bis zum Kleinen ziviler Umgangsformen wie einem Mindestrespekt vor dem politischen Gegner –, in Zweifel ziehen und das liberale Establishment aus ihren Machtpositionen – von Rundfunkhäusern bis zu Gerichten – jagen wollen.
Zur neuen kommunikativen Lage im Zeichen von Rechtspopulismus und Social Media gehört übrigens auch, dass Tagungen wie diese, die via Livestream übertragen wurde, von abwesenden Kritikern sozusagen kontrollgesichtet und dann sofort negativ kommentiert werden. Der User @PortalAlemania twitterte am Tagungstag: „Auf der #reclaim19 zeigt sich, daß [!] der klassische #Journalismus gemäß #Pressekodex tot zu sein scheint… Statt von Journalisten*Innen sollte man vielleicht mittlerweile von #Agenten*Innen sprechen…“ Leute sind das, die offenbar sehr viel Zeit haben, ihren Gegnern das Gefühl zu geben: Sie werden beobachtet.
Woher nur die Wut, woher der Hass? Koppetsch nannte als nur eine Ursache unter anderen eine „eskalierende Form sozialer Ungleichheit“ – um dann erstaunlicherweise, als konkretisierende Operationalisierung ihrer These, mehr die Euro-Finanzkrise und die Globalisierung als den sehr viel alltäglicheren „Hartz IV“-Komplex und dessen deklassierende Breitenwirkung zu nennen. Geschenkt. Die Soziologin hatte aber schon recht, wenn sie Journalisten empfahl, genauer hinzuschauen in die „gesellschaftlichen Arenen“, die nicht die ihren sind. Leitfrage: Was ist da schiefgelaufen?
Aber diese Frage wird eben zu selten und wenn, dann oft zu spät gestellt. Journalismus ist häufig (auch vom Autor dieser Zeilen) gewürdigt worden als Frühwarnsystem der informierten, der aufgeklärten Gesellschaft. Im Normalfall bleibt der Journalismus aber eben doch fixiert auf die Aktualität: Er reagiert häufiger auf ein Problem, einen Systemfehler, als dass er ihn antizipiert hätte. Ethnographische Erkundigungen im deutschen Alltag, in den Milieus derer, die keine Stimme haben, sind die Ausnahme – und wenn, führt dann das journalistische Bemühen zu schillernden Reporterpreisen, zu blitzlichthaften Thematisierungen, aber ohne weitere Konsequenzen. Es stimmt: Der Journalismus braucht eine Revision seiner Aufmerksamkeitslogik, wie Alexander Sängerlaub, der bei der Stiftung Neue Verantwortung über Desinformation forscht, auf der Hamburger Tagung in einem Zwischenruf bemerkte.
Ein zweites Problem ist sicherlich die Milieubefangenheit der durchschnittlichen Journalisten. Sie schreiben über und für ihresgleichen. Zugang zu den ihnen fremden Milieus finden sie kaum. Die Redaktionen reproduzieren sich selbst aus der immer gleichen Konformitätsblase des deutschen Mittelstands. Verständnis und Respekt für diejenigen, die auf der wohlstandsabgewandten Seite Deutschlands leben, entsteht so eher weniger.
Journalismus ist eben nicht nur Teil der Lösung, sondern auch Teil des Problems, wie Jakob Augstein sagte. Er wiederholte damit eine These, die der Verleger und Herausgeber des Freitag Anfang 2017 in einem Vortrag an der Universität Hamburg entwickelt hatte. Wo waren die angeblich so verantwortungsvollen Journalisten, wollte er jetzt in einer Diskussionsrunde mit Bascha Mika und Carsten Reinemann wissen. Wo waren sie denn, als es ernst wurde und die rechte Revolution am Horizont heraufzog?

Mika: Bei jedem mit der sogenannten Flüchtlingskrise konnotierten Ereignis werde einerseits Pro Asyl gefragt und andererseits die AfD. „Ja, warum denn!?“ Foto: Rudolf Augstein Stiftung
Mika, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, glaubt, in der Beantwortung einer Politik hin zu sozialer Ungerechtigkeit seien es zu wenige Stimmen gewesen, und die seien nicht durchgedrungen. Der Kommunikationswissenschaftler Reinemann aber wandte sich gegen die Annahme, kritische Berichterstattung sei ganz wirkungslos und könne die Demokratie nicht schützen: Wenn 80 Prozent der Deutschen sagen, die AfD grenze sich nicht genügend von Rechtsextremen ab, dann sei das auch ein Ergebnis von Berichterstattung.
Journalisten springen also nicht mehr über jedes Stöckchen, das ihnen die AfD hinhält? Nach dem Eindruck von Bascha Mika ist es so, wie es Bernd Gäbler in seiner zweiten Rechtspopulismus/Medien-Studie für die Otto Brenner Stiftung beschrieben hat. Aber es bleibe noch so viel zu tun, so Mika: „Wir sind immer noch in einer Komplizenschaft mit den Rechten in der Berichterstattung.“ Was sie damit meinte: Bei jedem mit der sogenannten Flüchtlingskrise konnotierten Ereignis werde einerseits Pro Asyl gefragt und andererseits die AfD. „Ja, warum denn!?“ rief Mika aus.
Nicht nur sie sieht hier eine falsche Ausgewogenheit am Werk, einen „bothsiderism“, eine „false balance“, wie sie seit längerem auch in der Kommunikationswissenschaft international diskutiert wird, so z.B. von Michael Brüggemann und Sven Engesser am Fallbeispiel der Berichterstattung über den Klimawandel. Stephanie Reuter, die als Stiftungs-Geschäftsführerin diese argumentenstarke Tagung konzipiert hatte, holte zu diesem Thema Prof. Whitney Phillips von der Syracuse University in New York nach Hamburg. Philipps hat intensiv zu dem Problem des journalistischen Umgangs mit Extremismus geforscht. Der von ihr im vergangenen Jahr vorgelegte Report „The Oxygen of Amplification. Better Practices for Reporting on Extremists, Antagonists, and Manipulators“, der im Netz in gleich drei Varianten abrufbar ist, verdient die nähere Auseinandersetzung.
„Strategic silence“ – so lautet eine von Philipps Empfehlungen. Keine unnötige Aufmerksamkeit für das Antidemokratische, Illiberale und Inhumane. Der Begriff kommt nicht zuletzt aus der Krisen-PR, wird aber eben auch wissenschaftlich diskutiert. Doch kann dieses scheinbar gebotene Schweigen eine Maxime für journalistisches Handeln sein? Im Sinne des Totschweigens ganz bestimmt nicht, weil dies dem journalistischen Prinzip des Berichtens, des Öffentlich-Machens, der Herstellung von Transparenz zuwiderliefe. Diesem Prinzip liegt ja die Annahme zugrunde, dass ,Öffentlich‘ immer besser ist als ,Nicht-Öffentlich‘. Nur wenn die Staatsbürger möglichst umfassend wissen, was Sache ist, können sie sich begründet entscheiden – für oder gegen etwas. Totschweigen wäre politisch gefährlich, weil es dem Lügen-, dem Lückenpresse-Vorwurf Feuer gibt. Aber selbst, wenn nicht: Kein Problem wird damit aus der Welt geschafft, kein Rechtspopulist, kein Rechtsextremer verschwindet deshalb von der Bildfläche.
Aber Philipps plädiert ja auch nicht für stures Schweigen, eher für eine Dosierung der Lautstärke in der Extremismus-Berichterstattung: „Minimize focus on intentions and origins. Maximize focus on impact and context“, sagte sie in Hamburg.
Am Beispiel von Gaulands „Vogelschiss“ würde das wohl bedeuten: sich nicht immer wieder wundern und empören und nachfragen: Wie konnte ein gebildeter Mann wie er das nur sagen? (Eine nutzlose Frage, die so oder ähnlich dutzendfach formuliert wurde – hilflose Irritation von Angehörigen desselben gebildeten Milieus.) Eher schon so:

In einem Workshop sprachen „unter drei“ RBB-Reporter Olaf Sundermeyer (links) und Melanie Amann (Mitte), Leiterin des Hauptstadtbüros des Spiegel, über Recherche-Schwierigkeiten in rechten Milieus – und wie man sie überwindet.
Die Konferenz „re:caim public discourse!“ kreiste ihr Thema vielfach mit zahlreichen kompetenten Referentinnen und Referenten ein. Zum Beispiel wurden in drei Workshops Spezialfragen wie „Europa: Angriffe auf die ,Vierte Gewalt‘“ (mit Christian Mihr und Márto Gergely) und „Countering Disinformation and Hate in the Digital Public Sphere“ (mit Raymond Serrato von der UN-Menschenrechtskommission, dem Youtuber Rayk Anders und Lena Frischlich von der Universität Münster) erörtert. In Workshop 2 sprachen „unter drei“ RBB-Reporter Olaf Sundermeyer und Melanie Amann, Leiterin des Hauptstadtbüros des Spiegel, über Recherche-Schwierigkeiten in rechten Milieus – und wie man sie überwindet.
Der nächste Schritt – von Analyse und Kritik hin zur demokratieförderlichen Aktion – wurde am nächsten Tag (23. Februar) von Augstein-Stipendiaten und –Projektpartnern vorbereitet. In einem Kreativ-Workshop bearbeiteten sie Themen und Fragen wie diese: „Wie erreichen wir auch die Demokratieverdrossenen?“
Die Diskussion um den angemessenen journalistischen Umgang mit politischem Extremismus wird weitergehen. Jakob Augstein hat zum Abschluss schon mal einen Stein ins Wasser geworfen. Ob vielleicht der Satz „des Gründers“, wie er Rudolf Augstein nannte – „Sagen, was ist“ – künftig eher lauten sollte: „Sagen, was sein sollte“ oder „Sagen, was sein kann“.
Man verstünde Jakob Augstein gründlich falsch, würde man annehmen, er habe dabei an hoffnungsfrohen „Constructive Journalism“ gedacht.

Der Constructive Journalism Day in Hamburg versuchte, mit Vorurteilen über lösungsorientierten Journalismus aufzuräumen. Unser Redakteur war für Netzwerk Recherche vor Ort.
von Malte Werner
Der konstruktive Journalismus hat in Deutschland immer noch ein Wahrnehmungsproblem. Es ist hinlänglich bekannt, dass Medien ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit zeichnen, weil die Berichterstattung oft vor allem negative Ereignisse in den Blick nimmt. Es ist auch bekannt, dass das beim Publikum nicht gut ankommt. Und trotzdem werden Ansätze, die daran etwas ändern möchten, schnell als „Kuscheljournalismus“ abgestempelt. Ursache für die reflexhafte Kritik dürfte ein mangelndes Verständnis für die Anliegen des konstruktiven Journalismus sein. Daran etwas zu ändern, war ein Ziel des Constructive Journalism Day, der am 14. Februar 2019 in Hamburg stattfand.

von Malte Werner
Wo beginnt Exil? Für den ehemaligen Chefredakteur der türkischen Zeitung Cumhurriyet und aktuell wohl bekanntesten ausländischen Journalisten im deutschen Exil, Can Dündar, stellt sich die Frage nicht erst im Angesicht von Flucht oder Vertreibung. „Your exile begins the moment you challenge the mainstream“, sagte der heutige Chefredakteur von ÖZGÜRÜZ bei der feierlichen Eröffnung des Exile Media Forum in der Hamburger Elbphilharmonie am 29. Oktober, dem Vorabend der eigentlichen Tagung. (mehr …)

Bild ist der Titanic auf den Leim gegangen – und was folgt daraus?
von Volker Lilienthal
Schon die Schlagzeile war die Unterstellung, diese Partei sei eine von Wiederholungstätern: „Neue Schmutzkampagne bei der SPD!“ Und dann weiter: „Es geht um brisante Mails, den Juso-Chef und einen Mann namens Juri“. Bild stieg darauf ein, wertete angebliche Mails aus und ließ sogar den getarnten Informanten in die eigene Redaktion. Am Ende kam heraus: Ein satirischer Fake war das, Aktionskunst aus dem Haus Titanic. Das reichweitenstarke Newsportal T-Online bat Message-Herausgeber Volker Lilienthal um eine Einordnung des Falls. Sein Gastbeitrag löste auf Twitter ein lebhaftes, hauptsächlich zustimmendes Echo aus. Message veröffentlicht nun eine aktualisierte und leicht erweiterte Fassung. Darin geht der Autor auch auf die immer wieder beliebte Frage ein: Was darf Satire?

Die Schlagzeile, mit der die Bild-Zeitung der Titanic auf den Leim ging.
Wenn ich in der jüngeren Vergangenheit als Experte nach der Bild-Zeitung gefragt wurde, habe ich mich um Differenzierung bemüht: seit langem kein rechtes Kampfblatt mehr, eher um gesellschaftlichen Ausgleich bemüht, zum Beispiel in der Flüchtlingskrise. Kritisch auch gegenüber AfD und Pegida, hin und wieder jedenfalls. Kollegen gibt es, die wollten Bild gar die Journalismus-Eigenschaft absprechen. Also wäre Bild nicht mehr vom Artikel 5 Grundgesetz geschützt? Ich widersprach.
Dabei bleibe ich. Doch meine sonstige Einschätzung, Bild habe sich sozusagen zivilisiert, ein Akt der Selbsterziehung oder der korrigierenden Reaktion auf so berechtigte wie nachhaltige Kritik, war blauäugig, ich nehme sie zurück. Die sogenannte Titelgeschichte über eine angebliche „Neue Schmutzkampagne bei der SPD!“ zeigte von Anfang an, dass Bild selten zögert, noch Öl ins Feuer zu gießen, wenn eine Partei, eine Regierung, ein Minister, eine Behörde oder was auch immer in einer Krise steckt und an Ansehen verliert. Dann nimmt Bild scheinbar belastendes Material gerne entgegen, nimmt ein paar Nachprüfungen vor, ob es echt ist – und selbst wenn dafür nicht viel spricht, darf die Geschichte nicht sterben.
„Totrecherchieren“, wie es im Journalistenjargon heißt, gilt hier nicht. Die Botschaft „Neue Schmutzkampagne bei der SPD!“ musste offenbar unbedingt gebracht werden, weil sie ins politische Konzept passte: eine Partei, die schon genug in Nöten steckte, nochmals vorzuführen. Seht her: Lassen sich sogar mit Russen ein! Nur wer bis zum Ende des wirren Textes, erschienen auf Seite 1 am 16. Februar, durchgehalten hatte, konnte eine kleine Distanzierung lesen: „Für die Echtheit der E-Mails gibt es keinen Beweis.“
Schon damals war klar: Bild hatte die journalistische Sorgfaltspflicht in erheblichem Maße verletzt. In deren Rahmen wäre es Aufgabe der Redaktion gewesen, den scheinbaren Mailwechsel und seinen Inhalt zu verifizieren. Offensichtlich ist dies aber nicht gelungen, Bild räumte es selbst ein. In einer solchen Situation aber wäre es Ausdruck wahrgenommener Verantwortung gewesen, auf diese Art von politisch motivierter Verdachtsberichterstattung zu verzichten. Oder aber den Artikel deutlicher kleiner zu fahren, auf hinteren Seiten zu platzieren und mit dem Zweifel an der Echtheit der Mails in den Text einzusteigen. Eine derart windige Geschichte aber auf Seite 1 zu heben, ist ein blattmacherisches Totalversagen. Ein Versagen vor allem auch des nunmehrigen Alleinherrschers von Bild, Julian Reichelt. Bekanntlich weiß der sein Blatt gut zu verkaufen, schreckt vor kaum einer Polarisierung (wie jüngst in Hart aber fair) zurück. Aber in der Stunde der Entscheidung fehlt ihm die Selbstdisziplin. Das Gespür, was man tun darf – und was man besser sein lassen sollte.
Vergessen wir nicht, dass Bild hier mit unbewiesenen – und nun auch widerlegten – Behauptungen in einen laufenden politischen Entscheidungsprozess eingegriffen hat. Wie sich die SPD-Basis entscheidet, ob pro oder contra GroKo, ist ja nicht ausgemacht. In einer solchen Situation mit einer Tendenzberichterstattung zu kommen, die geeignet war, den wortmächtigsten GroKo-Gegner, nämlich Juso-Chef Kevin Kühnert, politisch und moralisch zu deklassieren, war der unzulässige Versuch einer offenkundig politisch motivierten Intervention in einen Meinungsbildungsprozess. Klar, Journalisten berichten beständig über politische Entscheidungsprozesse, kritisieren deren Akteure, warnen vor drohenden Resultaten, befürworten andere. Aber sie tun dies selten mit unbewiesenen Tatsachenbehauptungen – und wenn, dann haben sie die Grenze zur Propaganda überschritten.
Natürlich sind die Grenzen des Machbaren bei Boulevardmedien weiter gesteckt als bei anderen. Hier darf zugespitzt werden. Nie aber dürfen die Fakten zurechtgedrechselt werden. Kampagnen verbieten sich. Wenn aber Bild beim laufenden Mitgliederentscheid der SPD-Basis mal insinnuiert, Ausländer dürften mitstimmen, vielleicht sogar ein Hund, und dann noch der Juso-Chef vorgeführt wird, der sich scheinbar mit Russen eingelassen hat, dann drängt sich der Eindruck einer Anti-SPD-Kampagne natürlich auf.
Nun rechtfertigt sich Bild-Chefredakteur Julian Reichelt damit, das Blatt habe ja gar nicht berichtet, dass sich Kühnert mit Russen eingelassen habe. Die Titanic habe insofern nicht ihr Ziel erreicht. Aber Bild hat sehr wohl den Eindruck erweckt, es könnte etwas dran sein: dass der Juso-Chef gerne die Hilfe von Russen in Anspruch nehmen könnte, damit die auf Facebook Stimmung gegen die GroKo machen. Hier aber ging Raunen vor Recherche. Denn der Eindruck konnte eben nicht bestätigt werden. Was man aber nicht beweisen kann, darüber muss man schweigen. Mutmaßungen desorientieren die Leser. Zur Information tragen sie nichts bei. Eher sind sie das, wovon wir demokratiebedrohend schon genug haben: Fake News.
Aber es kommt ja noch schlimmer. Nun ist raus, dass Titanic Bild aufs Glatteis geführt hat. Und wie leicht das war: „Eine anonyme Mail, zwei, drei Anrufe – und Bild druckt alles, was ihnen in die Agenda passt“, heißt es bei Titanic. Der Mitarbeiter des Satireblatts, Moritz Hürtgen, sprach sogar in der Bild-Zentrale vor, getarnt mit billiger Brille, und wurde ohne Ausweiskontrolle in die Redaktion vorgelassen. Das sei „hoch professionell organisierter Betrug“ gewesen, rechtfertigt sich Reichelt im Spiegel-Interview. Das „hoch professionell“ verwundert. Natürlich möchte Reichelt alles: nur nicht die Raffinesse von Titanic würdigen. Der Verweis auf die angebliche Professionalität soll eher sagen: ,So perfekt ausgeführt, dass wir es im Grunde gar nicht entdecken konnten‘.
Und noch eine Schutzbehauptung führt der Bild-Chefredakteur an: Angeblich war das Thema Kühnert und die Russen redaktionsintern schon vom Spielplan abgesetzt. Dann aber habe die SPD Rechtsmittel gegen Unbekannt angekündigt – und flugs eine neue Lage entstehen lassen, die den Nachrichtenwert wieder ins Unermessliche steigen ließ? Nichts da! Erstens sollten Strafanzeigen, ja selbst staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, erst recht die sogenannten Vorermittlungen tiefer gehängt werden. Sie besagen nämlich erst mal gar nichts, insinuieren aber in Nachrichtenform: Irgendwas wird schon dran sein. Sodann: Es war ja Bild, die erst die Aufregung in die SPD-Parteizentrale trug. Die Berichterstattung über einen mutmaßlichen Skandal ankündigte. Und die damit die Partei quasi zum Jagen trug. Das ist ein Leichtes: Strafanzeigen zu provozieren und hinterher selbstbestätigend darüber zu berichten. Übrigens: Reichelt hat die Verantwortung für die Blamage mittlerweile auf sich genommen, an Rücktritt aber nach eigenem Bekunden nicht gedacht.
Auf Twitter und anderen Orts wird nun anhaltend seit Tagen über #miomiogate gespottet: „Alter Schwede, hat sich die Bild blamiert“. Ja, hat sie. Aber mehr als das. Die Affäre zeigt: Auf Bild ist kein Verlass. Politiker, die mit dem Boulevardblatt ihm Fahrstuhl nach oben gefahren sind und dann wieder nach unten (Mathias Döpfner), wissen das schon länger. Vor allem aber wir als Leser dürfen das nie vergessen: Bild steht nicht für eine verlässliche Nachrichtengebung, für eine vernunftbetonte und hinreichend umfassende Information, die wir alle zur Orientierung in einer unüberschaubaren Welt brauchen. Diese Zeitung und ihre Webvariante sind flackernde Irrlichter im Zeitgespräch der Gesellschaft. Man kann das lesen, hin und wieder jedenfalls, wenn man es zu verdauen versteht. Verlassen aber sollte man sich darauf nicht.
Bild hat in diesem Kasus von nicht unerheblicher politischer Bedeutung vor aller Augen offenbart, dass a) in der Nachrichtenwerthierarchie von Bild noch immer Effekt und Skandal vor Sorgfalt und Verzicht rangieren, dass b) die internen Verfahren zur Verifikation und, mehr noch, zur Falsifikation von Informationen nicht gut funktionieren und dass c) die Redaktion offenbar schrecklich vergesslich ist.
Denn es ist ja nicht das erste Mal, dass Titanic Journalisten leimte. Bei allem, was auf den ersten Blick bizarr erscheint, sollten in jeder Redaktion die Alarmglocken läuten: Will uns hier jemand hinters Licht führen? Die Bild hätte wissen müssen, dass sie für solche Guerillaaktionen ein besonders attraktives Objekt ist. Hat man bei Bild noch nie vom „Project Veritas“ gehört? Davon, dass der Washington Post unlängst eine erfundene Missbrauchsgeschichte untergejubelt werden sollte? Die Washington Post-Reporter blieben skeptisch und ersparten ihrem Blatt die Blamage. Davor hätte sich auch Bild schützen können, wenn die Redaktion nicht leichtfertig und fahrlässig nach der Leimrute einer Anti-SPD-Kampagne gegriffen hätte.
Allerdings gibt es auch keinen Grund, die Aktionssatire von Titanic etwa als investigative Medienkritik zu adeln. Zunächst haben wir rein empirisch zur Kenntnis zu nehmen, dass die neuere Satire sich längst nicht mehr damit begnügt, Äußerungen und Handlungen von Politikern – oder wie hier: Medien – hinterher bloß spitz zu kommentieren. Vielmehr bewegt sie sich zunehmend ins alltägliche Arbeitsfeld ihrer Zielobjekte hinein und setzt dort gezielt Köder, provokante Stimuli, die die eine oder andere Reaktion auslösen sollen.
Am Beispiel von Jan Böhmermann gesagt: Das kann zu erhellenden, dekuvrierenden Effekten führen – Stichwort: #verafake –, aber auch zu fahrlässig gestreuten Platzierungen von Bildfälschungen im Internet, auf die im Falle von #varoufake die Redaktion von „Günther Jauch“ hereingefallen ist. Bei diesem Fall aus dem Jahr 2015 spekulierten Böhmermann und sei Team natürlich auch auf die damals weitverbreitete anti-griechische Stimmung. Musste man denen nicht selbst den Stinkefinger zutrauen? Drei Jahre später: Satirische Guerilla-Aktionen wie die von Titanic exploitieren natürlich auch ein gärendes Misstrauen in Medien. Im Grunde verwandeln sie das Lügenpresse-Geraune in einen Gegenstand satirischer Unterhaltung. Und nachher schlagen sich alle auf die Schenkel und rufen: Ertappt!
Von Satirikern kann man normativ wohl nicht erwarten, dass sie solche Zusammenhänge reflektieren. Dass sie sich auf skeptische Nachfragen ernsthaft einlassen, wie jüngst ein Hürtgen-Interview in der Jungen Welt zeigte. Oder dass sie wählerisch sein sollten in der Wahl ihrer Foren, in denen sie ihre Scoops absatzsteigernd nachauswerten. Den eigenen Erfolg am Köcheln zu halten ist legitim, denn auch Titanic-Hefte wollen ja verkauft sein. Aber muss es gleich RT Deutsch sein, wo man auf Fragen antwortet? Moritz Hürtgen war sich dafür nicht zu schade, Reichelt warf ihm daraufhin vor, sich vor den Karren russischer Propaganda spannen zu lassen. Doch wer sich das Kurzinterview anhört, merkt: Auch die Antworten sind Satire. Wohl ebenso, wie wenn Hürtgen nach einem „Hessenschau“-Interview twittert, er bedauere, dieses je gegeben zu haben.
Wir leben in nervösen Zeiten. Das politische Deutschland dreht schon seit längerem hohl. Auch die seriösen Medien stehen vielfach unter Druck. Sie wollen nicht der Duchlauferhitzer für Hetze aus der rechten Ecke sein. Und werden es doch, einfach weil sie ab einer bestimmten Relevanzschwelle dann doch über das hingehaltene braune Stöckchen springen und über den neuesten Tabubruch berichten. Der dann am Ende schrecklich normal wirkt und niemand regt sich mehr auf. Und dann die Social Media, die längst nicht mehr demokratische Spielwiese für die freie Meinungsäußerung aller sind, sondern vermintes Gelände propagandistischer Manipulation, wie die aktuelle Berichte über „Reconquista Germanica“ zeigen.
In einer solchen Situation brauchen wir verantwortlichen Journalismus, der die Stimme der Vernunft erhebt, der Tatsachen von Lügen scheidet und der bei aller Freiheit und Notwendigkeit der Kritik an politischem Handeln das gemeinsame Interesse aller Bürger nicht aus dem Auge verliert: in einem freiheitlichen, sozialen Rechtsstaat zu leben, in einer Gesellschaft, die Konflikte zivilisiert, ohne Gewalt ausgeträgt, in der die Rechte von Minderheiten respektiert werden und in der alle zusammen klüger, nicht dümmer werden wollen. Man nennt es auch: Aufklärung. Bild hat eine andere, sehr volatile Agenda.
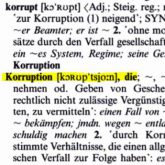
von Volker Lilienthal
In diesen Zeiten zur Korruption im Journalismus zu forschen und darüber öffentlich zu sprechen, ist heikel. Sie kennen das Schimpfwort „Lügenpresse“. Sind doch alle korrupt – bezahlt von den Eliten dieses Landes –, auch solche Unterstellungen gehören zum wahnhaften Vorstellungskomplex „Lügenpresse“.
Auf dieses Konto wollen wir natürlich nicht einzahlen, wenn wir heute über Korruption im Journalismus sprechen. Wir wollen nicht pauschalisieren und behaupten nicht: Alle Journalisten sind korrupt. Wir sagen nicht einmal: Viele Medienmitarbeiter seien dies. Aber: es gibt das Problem. Manche Journalisten und ihre Medienbetriebe zeigen sich aufgrund von Interessen oder unter spezifischen marktgetriebenen Zwängen offen für Korruption. Und es gibt in dieser Gesellschaft natürlich Kräfte und Machtpole, die sich Journalisten und Medien korruptiv nähern, um ihre eigenen Interessen und Sichtweisen in die Öffentlichkeit zu tragen. Oder, im Gegenteil, um zu verhindern, dass bestimmte Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. (mehr …)