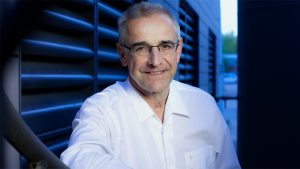Medienkritik
„Wir Journalisten bewegen uns in einem Dilemma“
Interview mit Stefan Wels, dem Leiter des Investigativ-Ressorts des NDR, über die Kritik an der Verdachtsberichterstattung rund um den BAMF-Skandal. Die Investigation des NDR arbeitete in dem Fall mit der Süddeutschen Zeitung und Radio Bremen zusammen.
Herr Wels, erinnern Sie sich noch an die ersten Rechercheschritte? Wie hat alles angefangen?
Wels: Wir wussten, dass es da ein großes Verfahren mit einer Durchsuchungsmaßnahme gibt. Wir kannten die Umrisse und den juristischen Verdacht, auf dem die Maßnahme beruhte. Es war relativ klar, dass es eine große Durchsuchungsmaßnahme gibt. Von diesem Moment an haben wir alles daran gesetzt, zu erfahren, was die Betroffenen zu den Vorwürfen sagen.
Haben sie redaktionsintern Druck gespürt, so schnell wie möglich zu publizieren?
So eine große Exekutivmaßnahme bleibt in einer kleinen Stadt wie Bremen nicht unter dem Deckel. Deswegen gab es bei uns die Einschätzung, dass wir mit der Veröffentlichung nicht wahnsinnig lange warten können. Wir kannten den Vorgang etwa einen Tag, bis wir dann publiziert haben. Diesen Tag haben wir genutzt, um die Angaben zu dem Verfahren zu verifizieren. Sobald uns eine zweite Quelle die Information, dass es eine groß angelegte Durchsuchung gab, bestätigt hatte, haben wir berichtet.
Journalisten sollten Betroffenen die Möglichkeit zur Stellungnahme geben.
Ich glaube, der große Grundsatz der Verdachtsberichterstattung muss sein, dass Sie alles tun, was Sie tun können, um die Betroffenen dazu zu hören und ihre Position abzubilden. Sie bemühen sich zwar mit aller Kraft darum, die Gegenseite zu hören. Es dauert bei solchen Verfahren aber oft, bis sich die Betroffenen öffnen. Das kann man beklagen und ist auch irgendwie doof. Aber die Betroffenen müssen sich erst einmal sortieren, wie sie damit umgehen, Gegenstand von öffentlichem Interesse und einem öffentlichen Verfahren zu werden.
Inwiefern hat man das bei Ulrike B. gemacht? Haben Sie die Betroffenen für eine erste Berichterstattung angehört?
Die Kollegen in Bremen haben die ehemalige Leiterin und natürlich die Behörde kontaktiert. Auch die Anwälte der Verdächtigen haben wir am ersten Tag, sobald wir die Kontaktdaten hatten, angefragt. Allerdings ließen Letztere unsere Anfragen zunächst unbeantwortet und die Leiterin war für uns am ersten Tag nicht erreichbar. Das heißt: Trotz aller Bemühungen kam keine Kommunikation zu Stande. Das haben wir in unseren Texten auch genau so abgebildet, etwa mit Hinweisen wie „war für eine Stellungnahme nicht erreichbar“ oder „ließen Anfragen unbeantwortet“. Die ersten Rückläufe von Seiten der Anwälte kamen dann 48 Stunden später.
Haben Sie in der Redaktion über die Namensnennung und Identifizierbarkeit von Ulrike B. diskutiert?
Darüber diskutieren wir immer und stimmten uns mit dem Justitiariat ab. Ich habe mir unsere alten Texte vom ersten Tag noch einmal angeschaut: Darin sprechen wir von einer leitenden Mitarbeiterin und von der ehemaligen Leiterin. Das halte ich auch heute noch für notwendig, da es zeigt, dass sich ein Verdacht gegen die Spitze eines Hauses richtet. Ulrike B. ist, wenn man von der ehemaligen Leiterin spricht, natürlich identifizierbar. Man kann das nicht verhindern. Aus meiner Sicht gibt es auch keine Notwendigkeit dazu.
Wie wichtig ist es, die Berichterstattung auch als eine „Verdachtsberichterstattung“ zu kennzeichnen? Braucht es hierfür einen Disclaimer?
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Man muss deutlich machen, dass es sich um eine Berichterstattung handelt, die auf einem Verdacht beruht, und dass es um ein Verfahren mit einem gewissen Verfahrensstand geht, dessen Ausgang noch offen ist. Man sollte klarstellen, welche Sichtweise von welcher Behörde oder Ermittlungsbehörde ist, und dass zur Frage, wer letztendlich schuld ist, noch keine Aussage gemacht werden kann. Man sollte das sehr deutlich markieren.
Die Medienberichterstattung über den BAMF-Skandal hat viel Kritik geerntet. Journalist Lorenz Matzat behauptet, der BAMF-Skandal sei eigentlich ein Presse-Skandal. Die Verdachtsberichterstattung vieler Medien sei fahrlässig gewesen. Wann ist Ihnen bei der Recherche klar geworden, dass da etwas ganz anders läuft, als ursprünglich gedacht?
Ich glaube, es ist gut, wenn so eine Berichterstattung aufgegriffen und diskutiert wird. Ich möchte aber klarstellen, dass die Berichterstattung, dass es ein Verfahren gibt, richtig war. Wir haben schon früh in der Berichterstattung deutlich gemacht, dass das Ganze auf einer sehr schmalen Faktenlage der Ermittler beruht. Der Punkt, an dem wir zunehmend in Zweifel geraten sind – nicht, ob es das Verfahren überhaupt gibt, aber wie fundiert die Behauptungen sind – setzte erst Tage später ein. Das kommt erst in dem Moment, in dem man Kenntnis über mehr Dokumente erlangt.
Was waren das für Zweifel?
Es lagen Irrtümer in der Rechtslage vor und das BAMF hat aus unserer Sicht bestimmte Sachverhalte nicht korrekt eingeschätzt. So summierten sich die Zweifel. Stimmen die Dimensionen? Stimmen die Vorwürfe? Wie ist es zu bewerten, dass da eine Form von verschwörerischer Gesamtkonstellation herrscht? Da hat sich dann auch herausgestellt, auf welche früheren vagen Verdachtsmomente sich das Ganze gegründet hat. Wir hatten das Gefühl, dass sich die Strafverfolger sehr kritische Nachfragen gefallen lassen müssen. Die haben wir auch gestellt. Wenn wir am Anfang einen Verdacht transportieren, der so sorgfältig und gründlich wie möglich recherchiert wurde, dann aber merken, dass unsere Erkenntnisse sukzessive im Widerspruch dazu stehen, müssen wir auch über die Zweifel mit gleicher Kraft und Intensität berichten. Da sind wir bis heute dran. Wir werden diese Geschichte bis zum Ende begleiten. Denn es kann nicht sein, dass man sich dann irgendwann aus einer Berichterstattung verabschiedet und am Ende etwas im Raum stehen bleibt, was falsche Eindrücke erweckt. Ich glaube, meine Kollegen haben eine sehr gute Arbeit geleistet. Sie haben mit Vehemenz und großer Intensität gearbeitet.
Wobei man jetzt provokativ sagen könnte, der Rechercheverbund hätte ja auch alles einmal in Zweifel ziehen können, bevor er mit der Meldung raus geht.
Das ist sehr richtig. In diesem Fall wäre es für uns und vielleicht auch für die Betroffenen besser gewesen. Aber jetzt stellen Sie sich vor: Sie wissen von dem Verdacht, Sie wissen von dem Verfahren und Sie wissen von den Exekutivmaßnahmen. Und dann berichten Sie nicht, sondern versuchen erst einmal über einen langen Zeitraum in Zweifel zu ziehen, ob das Verfahren tatsächlich so ist, wie es die Strafverfolgungsbehörden darlegen. Das halte ich – um es klar zu sagen – für nicht praktikabel und auch nicht für sinnvoll. Ich denke, das entspricht nicht dem Informationsbedürfnis der Leute, wenn es um Verfahren geht, die einen gewissen Reifegrad haben. Ich glaube, dass dieses hartnäckige, kritische Begleiten des Verfahrens das ist, woraus journalistische Verantwortung erwächst.
Haben Sie sich Gedanken gemacht, was eine solche Berichterstattung für die Betroffenen bedeutet?
Ja. Das ist auch ein wesentliches Kriterium für mich. Fühlen sich die Verfahrensbeteiligten vom NDR fair behandelt? Haben sie das Gefühl, dass ihre Argumente zu dem Zeitpunkt, als sie gefallen sind, auch gehört wurden? Und auch in angemessenem Ausmaß? Das können Sie nur nach bestem Wissen und Gewissen machen. Sie können nur versuchen, das Bild möglichst genau zu zeichnen. Und Sie werden immer damit zu tun haben, dass sich das Bild weitet – von Tag zu Tag und mit der Offenbarung weiterer Quellen. Dann müssen Sie versuchen, das Bild über die Zeit so anzupassen, dass es am Ende korrekt ist.
Als Journalist geht man davon aus, dass Behörden und Strafverfolger vertrauenswürdig sind. Im Fall von Ulrike B. haben die Behörden aber offensichtlich nicht sauber gearbeitet. Wirft das die Frage auf, ob Journalisten überhaupt noch auf scheinbar privilegierte Quellen vertrauen können?
Ja, das Verfahren hat mich schon erstaunt. Es geht immer um die Frage, was privilegierte Quellen sind. Bei einer Behörde muss man eigentlich eine gewisse Sorgfalt annehmen. Doch ich glaube, dass das BAMF bei der Bewertung des Vorfalls an einigen Stellen erratisch war. Das habe ich daraus gelernt.
Was nehmen Sie persönlich noch aus diesem Fall der Verdachtsberichterstattung mit?
Wir Journalisten bewegen uns da in einem Dilemma und müssen wahnsinnig darauf achten, dass wir die Grundlage dessen, was wir als Verdachtsberichterstattung setzen, für das Publikum klar machen. Deshalb müssen wir in unseren Formulierungen auch immer benennen, auf wen wir uns beziehen, also ob auf Äußerungen zur Verdachtslage von der Staatsanwaltschaft oder vom BAMF zum Beispiel. Damit müssen wir auch die nötige Distanz in die Berichterstattung tragen.
Das Interview führten Magdalena Neubig, Laura Rihm und Nele Wehmöller.